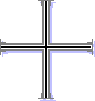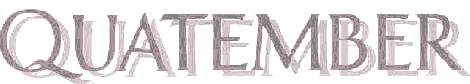Wenn man die Evangelische Michaelsbruderschaft und den Berneuchener Dienst als eine liturgische Bewegung bezeichnen - und damit im protestantischen Raum gelegentlich auch abqualifizieren - will, wird man weder ihrer ursprünglichen Motivation noch der nunmehr fünfzigjährigen Wirksamkeit und gegenwärtigen Erscheinung gerecht. Von Anfang an ist hier nach der umfassenden Erneuerung der Kirche gefragt worden und nach ihrem Dienst in unserer Zeit. Daß dabei der gottesdienstlichen Praxis im weitesten Sinne und der Liturgie im engeren besondere Aufmerksamkeit zugewandt wurde, ist ganz folgerichtig gewesen, das Neuwerden der Kirche erschöpft sich aber nicht hierin. Die Bruderschaft hat in allen Bereichen des kirchlichen Lebens ihren Beitrag geleistet. Sie hat bedeutende Prediger, Liturgen und Förderer der Diakonie hervorgebracht. Die Zahl der aus ihrer Mitte an die Universitäten berufenen Praktischen Theologen ist auffallend groß. Auch war ihr das Gespräch über die Grenzen der Theologie hinaus und die Arbeit im gesellschaftlichen Bereich immer wichtig. Wenn man die Evangelische Michaelsbruderschaft und den Berneuchener Dienst als eine liturgische Bewegung bezeichnen - und damit im protestantischen Raum gelegentlich auch abqualifizieren - will, wird man weder ihrer ursprünglichen Motivation noch der nunmehr fünfzigjährigen Wirksamkeit und gegenwärtigen Erscheinung gerecht. Von Anfang an ist hier nach der umfassenden Erneuerung der Kirche gefragt worden und nach ihrem Dienst in unserer Zeit. Daß dabei der gottesdienstlichen Praxis im weitesten Sinne und der Liturgie im engeren besondere Aufmerksamkeit zugewandt wurde, ist ganz folgerichtig gewesen, das Neuwerden der Kirche erschöpft sich aber nicht hierin. Die Bruderschaft hat in allen Bereichen des kirchlichen Lebens ihren Beitrag geleistet. Sie hat bedeutende Prediger, Liturgen und Förderer der Diakonie hervorgebracht. Die Zahl der aus ihrer Mitte an die Universitäten berufenen Praktischen Theologen ist auffallend groß. Auch war ihr das Gespräch über die Grenzen der Theologie hinaus und die Arbeit im gesellschaftlichen Bereich immer wichtig.
 Wie aber läßt sich der Dienst der Kirche, wie er in unserer Mitte gesehen und geübt werden muß, kurz und bündig beschreiben? Die Trias Martyria - Leiturgia - Diakonia wird dazu seit einiger Zeit verwandt. Man könnte diese Formel heute aufgrund der vor allem in der ökumenischen Bemühung um ein gemeinsames Eucharistieverständnis gewonnenen Einsichten durch einen vierten Begriff erweitern, den der Koinonia (Anteilhabe, Gemeinschaft). Zunächst aber sollte die bereits eingeführte und das Denken vieler um den künftigen Weg und die Erneuerung der Kirche besorgter Christen und Gruppen verbindende triadische Formel nach ihrer Herkunft, neutestamentlichen Begründung und Gegenwartsbedeutung befragt werden. Dabei wird sich uns ein nicht uninteressanter Einblick in die Arbeit und den Weg der Michaelsbruderschaft eröffnen, wie sie das erste halbe Jahrhundert ihres Bestehens, auf das wir in diesem Jahr zurückblicken, bestimmt haben. Wie aber läßt sich der Dienst der Kirche, wie er in unserer Mitte gesehen und geübt werden muß, kurz und bündig beschreiben? Die Trias Martyria - Leiturgia - Diakonia wird dazu seit einiger Zeit verwandt. Man könnte diese Formel heute aufgrund der vor allem in der ökumenischen Bemühung um ein gemeinsames Eucharistieverständnis gewonnenen Einsichten durch einen vierten Begriff erweitern, den der Koinonia (Anteilhabe, Gemeinschaft). Zunächst aber sollte die bereits eingeführte und das Denken vieler um den künftigen Weg und die Erneuerung der Kirche besorgter Christen und Gruppen verbindende triadische Formel nach ihrer Herkunft, neutestamentlichen Begründung und Gegenwartsbedeutung befragt werden. Dabei wird sich uns ein nicht uninteressanter Einblick in die Arbeit und den Weg der Michaelsbruderschaft eröffnen, wie sie das erste halbe Jahrhundert ihres Bestehens, auf das wir in diesem Jahr zurückblicken, bestimmt haben.
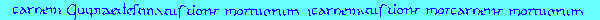
 Woher kommt die Formel? Oskar Planck, einer der Stifter der Evangelischen Michaelsbruderschaft und der erste Hausvater des Berneuchener Hauses im Kloster Kirchberg ist es gewesen, der die drei neutestamentlichen Begriffe Martyria - Leiturgia - Diakonia zur Kennzeichnung der dreifaltigen Einheit alles kirchlichen Denkens und Handelns zusammengestellt und - wohl im Jahre 1935 auf einer Probebrüderwoche der Evangelischen Michaelsbruderschaft - erstmals verwendet hat. Trinitarisches Denken, das "nicht etwa die Jesus-Verehrung zum Ersatz des mangelnden Gottesglaubens macht, sondern auch die Ehrfurcht vor dem Schöpfungswirken Gottes einbezieht" (Wilhelm Stählin) stand dabei Pate. Die innere Einheit von Martyria, Leiturgia und Diakonia hat dann die ganze Berneuchener Arbeit weiter bestimmt und wurde nach dem Kriege ausdrücklich thematisiert. Wilhelm Stählin hat eine Betrachtung über den Dienst der Engel unter den "biblischen Dreiklang der martyria, leitourgia und diakonia", der sich anbietet, "die Mannigfaltigkeit, ja die verschiedene Bewegungsrichtung dieser kirchlichen Lebensformen und -funktionen anzudeuten", gestellt (Symbolon 1958, 283 ff.), Karl Bernhard Ritter die innere Verbindung von Leiturgia und Diakonie herausgearbeitet (Kirche und Wirklichkeit 1971, 74 ff.). Woher kommt die Formel? Oskar Planck, einer der Stifter der Evangelischen Michaelsbruderschaft und der erste Hausvater des Berneuchener Hauses im Kloster Kirchberg ist es gewesen, der die drei neutestamentlichen Begriffe Martyria - Leiturgia - Diakonia zur Kennzeichnung der dreifaltigen Einheit alles kirchlichen Denkens und Handelns zusammengestellt und - wohl im Jahre 1935 auf einer Probebrüderwoche der Evangelischen Michaelsbruderschaft - erstmals verwendet hat. Trinitarisches Denken, das "nicht etwa die Jesus-Verehrung zum Ersatz des mangelnden Gottesglaubens macht, sondern auch die Ehrfurcht vor dem Schöpfungswirken Gottes einbezieht" (Wilhelm Stählin) stand dabei Pate. Die innere Einheit von Martyria, Leiturgia und Diakonia hat dann die ganze Berneuchener Arbeit weiter bestimmt und wurde nach dem Kriege ausdrücklich thematisiert. Wilhelm Stählin hat eine Betrachtung über den Dienst der Engel unter den "biblischen Dreiklang der martyria, leitourgia und diakonia", der sich anbietet, "die Mannigfaltigkeit, ja die verschiedene Bewegungsrichtung dieser kirchlichen Lebensformen und -funktionen anzudeuten", gestellt (Symbolon 1958, 283 ff.), Karl Bernhard Ritter die innere Verbindung von Leiturgia und Diakonie herausgearbeitet (Kirche und Wirklichkeit 1971, 74 ff.).
 Die Formel hat Oskar Planck geprägt. Die Sache aber ist älter. Schon auf der ersten Berneuchener Konferenz 1923 ging es um die Wahrheitsfrage, den Kultus und die praktischen Aufgaben, also um Verkündigung, Gottesdienst und dienende Liebe. In seinen Lebenserinnerungen schreibt Wilhelm Stählin: "Immer, von Anfang an und bis heute, ging es uns um die Verwirklichung des Evangeliums in eher glaubwürdigen Gestalt der Kirche, im Gegensatz ebenso zu jeder isolierten 'reinen Lehre' wie zu jeder ästhetischen oder pädagogischen Auffassung des Kultus und wie zu jeder rein individualistischen Frömmigkeit abseits von den Formen lebendiger Gemeinschaft" (Via vitae 1968, 317). Die Formel hat Oskar Planck geprägt. Die Sache aber ist älter. Schon auf der ersten Berneuchener Konferenz 1923 ging es um die Wahrheitsfrage, den Kultus und die praktischen Aufgaben, also um Verkündigung, Gottesdienst und dienende Liebe. In seinen Lebenserinnerungen schreibt Wilhelm Stählin: "Immer, von Anfang an und bis heute, ging es uns um die Verwirklichung des Evangeliums in eher glaubwürdigen Gestalt der Kirche, im Gegensatz ebenso zu jeder isolierten 'reinen Lehre' wie zu jeder ästhetischen oder pädagogischen Auffassung des Kultus und wie zu jeder rein individualistischen Frömmigkeit abseits von den Formen lebendiger Gemeinschaft" (Via vitae 1968, 317).
 Wir können Vorläufer der Formel noch früher und öfter finden, so zum Beispiel in dem Aufruf, mit dem Wilhelm Löhe 1844 seine Drei Bücher von der Kirche beschließt: Wir können Vorläufer der Formel noch früher und öfter finden, so zum Beispiel in dem Aufruf, mit dem Wilhelm Löhe 1844 seine Drei Bücher von der Kirche beschließt:
"Laßt uns einig sein:
Einerlei Wort und Lehre,
einerlei Praxis der Lehrer,
einerlei Lobgesang sei unter uns".
Wir können in der ökumenischen Bewegung ähnliche Erkenntnisse finden, die sich zum Beispiel auch in der Gründung der beiden 1948 zum Ökumenischen Rat der Kirchen vereinigten Bewegungen Glauben und Kirchenverfassung (Faith and Order: Verkündigung und Gottesdienst) und Praktisches Christentum (Life and Work: Diakonie) niederschlagen.
 Wichtiger als historische Linien zu verfolgen, wird die Klärung der Frage sein, ob die Zusammenstellung von Martyria, Leiturgia und Diakonia zur Bezeichnung der dreifaltigen Einigkeit alles kirchlichen Denkens und Handelns deren neutestamentlicher Bedeutung entspricht. Und hier werden wir auf einige Schwierigkeiten stoßen. Wichtiger als historische Linien zu verfolgen, wird die Klärung der Frage sein, ob die Zusammenstellung von Martyria, Leiturgia und Diakonia zur Bezeichnung der dreifaltigen Einigkeit alles kirchlichen Denkens und Handelns deren neutestamentlicher Bedeutung entspricht. Und hier werden wir auf einige Schwierigkeiten stoßen.
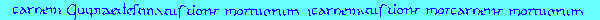
 Zunächst Martyria = Zeugnis. Wir finden diesen Begriff und die zu seiner Wortgruppe gehörenden Formen (martyrion - Zeugnis, Beweis, martyrein = Zeugnis ablegen und martys = Zeuge) im Neuen Testament zunächst im ursprünglichen Wortgebrauch des klassischen Griechisch und der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, als Zeugnis vor Gericht, so im Prozeß Jesu (Mk 14, 55). Der paulinische Sprachgebrauch, der sich zunächst auf der gleichen Ebene bewegt (1. Kor 15, 14 ff.), führt dann 1. Kor 1, 6 zu einer neuen Bedeutung des Begriffes martyrion: "Das Zeugnis - Luther übersetzt: Die Predigt - von Christus ist bei euch fest geworden." Ähnlich das Herrenwort an Paulus: "Dein Zeugnis von mir werden sie nicht annehmen" (Apg 22, 18). In der Aussendungsrede Mt 10, 18 wird den Jüngern Verhaftung und Verhör vorausgesagt, dies geschieht aber "zu einem Zeugnis vor ihnen und den Heiden": Es wird ihnen Gelegenheit gegeben, Christus vor den Mächtigen der Welt zu bezeugen. Die enge Verbindung von Zeugnis und Martyrium in dem Sinn, in dem die deutsche Sprache das Fremdwort aufgenommen hat, wird hier sichtbar. Martyria und Märtyrer gehören zusammen. Zunächst Martyria = Zeugnis. Wir finden diesen Begriff und die zu seiner Wortgruppe gehörenden Formen (martyrion - Zeugnis, Beweis, martyrein = Zeugnis ablegen und martys = Zeuge) im Neuen Testament zunächst im ursprünglichen Wortgebrauch des klassischen Griechisch und der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, als Zeugnis vor Gericht, so im Prozeß Jesu (Mk 14, 55). Der paulinische Sprachgebrauch, der sich zunächst auf der gleichen Ebene bewegt (1. Kor 15, 14 ff.), führt dann 1. Kor 1, 6 zu einer neuen Bedeutung des Begriffes martyrion: "Das Zeugnis - Luther übersetzt: Die Predigt - von Christus ist bei euch fest geworden." Ähnlich das Herrenwort an Paulus: "Dein Zeugnis von mir werden sie nicht annehmen" (Apg 22, 18). In der Aussendungsrede Mt 10, 18 wird den Jüngern Verhaftung und Verhör vorausgesagt, dies geschieht aber "zu einem Zeugnis vor ihnen und den Heiden": Es wird ihnen Gelegenheit gegeben, Christus vor den Mächtigen der Welt zu bezeugen. Die enge Verbindung von Zeugnis und Martyrium in dem Sinn, in dem die deutsche Sprache das Fremdwort aufgenommen hat, wird hier sichtbar. Martyria und Märtyrer gehören zusammen.
 Vor allem aber sind es die johanneischen Schriften, in denen der Begriff martyria eine zentrale Bedeutung bekommt; erscheint er doch auch zahlenmäßig hier am häufigsten, nämlich in 30 von 37 Stellen des Neuen Testaments. Martyria ist das auf Glauben abzielende werbende Zeugnis über Christi Wesen und Bedeutung. Dies Christuszeugnis drückt das Geschehen der göttlichen Offenbarungsmitteilung aus und wird abgelegt Vor allem aber sind es die johanneischen Schriften, in denen der Begriff martyria eine zentrale Bedeutung bekommt; erscheint er doch auch zahlenmäßig hier am häufigsten, nämlich in 30 von 37 Stellen des Neuen Testaments. Martyria ist das auf Glauben abzielende werbende Zeugnis über Christi Wesen und Bedeutung. Dies Christuszeugnis drückt das Geschehen der göttlichen Offenbarungsmitteilung aus und wird abgelegt
- als hinweisendes Zeugnis des Täufers und der Schrift (Joh. 1, 7; 5, 39)
- als Selbstzeugnis Jesu, das vom Zeugnis des Vaters legitimiert wird und sich nicht durch menschliche Logik und objektiv nachprüfbare Tatbestände feststellen läßt (Joh 8, 14; 5, 36 ff.; 18,37). Im Selbstzeugnis Jesu erfolgt die Offenbarung Gottes, die sich nur der gläubigen Annahme erschließt.
- als verweisend-proklamierendes Zeugnis der Jünger, das die Vollmacht des durch Jesus vorn Vater gesandten Parakleten, des Geistes, voraussetzt: "Auch ihr werdet meine Zeugen sein, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen." (Joh 15, 26 f.) Dies Zeugnis der Jünger als der berufenen Augenzeugen Jesu gewinnt dann im 1. Johannesbrief noch einmal besondere Bedeutung (1, 2; 4, 14). Bleibt nur noch hinzuzufügen, daß der Seher der Offenbarung die Martyria Jesu Christi, das Zeugnis von Jesus Christus, mit dem Wort Gottes gleichsetzt (logos tou theou) (Offb 1, 2). Hier wird auch besonders deutlich, daß der Martyria eine Kraft innewohnt, die den Menschen nicht nur Erkenntnisse verleiht, sondern sie auch in Bewegung setzt: Sie gibt teil am Weg, aber auch am Leiden und der Verfolgung Christi und zieht in sein Leben hinein (Offb 6, 9; 12, 11). Freilich ist nicht der Märtyrertod das Charakteristische des Zeugen, sondern eben sein Zeugnis von Jesus Christus.
 Wir sehen mit diesem neutestamentlichen Befund eine deutliche Linie von der Martyria des Vorläufers und der Schrift, Jesu und des Vaters, sowie der Jünger in der Kraft des Geistes hin zur Gegenwartsbedeutung der Martyria für das Leben der Kirche. Es geht nicht um religiöse Belehrung, sondern um die vollmächtige Bezeugung der in Jesus Christus geschehenen Offenbarung des lebendigen Gottes, aus der allein Glaube entsteht: Die neutestamentliche Martyria greift unmittelbar hinein in unsere heutige Wirklichkeit. Wir sehen mit diesem neutestamentlichen Befund eine deutliche Linie von der Martyria des Vorläufers und der Schrift, Jesu und des Vaters, sowie der Jünger in der Kraft des Geistes hin zur Gegenwartsbedeutung der Martyria für das Leben der Kirche. Es geht nicht um religiöse Belehrung, sondern um die vollmächtige Bezeugung der in Jesus Christus geschehenen Offenbarung des lebendigen Gottes, aus der allein Glaube entsteht: Die neutestamentliche Martyria greift unmittelbar hinein in unsere heutige Wirklichkeit.
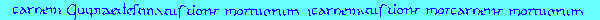
 Mit Leiturgia ist es nicht so einfach: Unser Gebrauch des Begriffes Liturgie läßt sich nicht oder zumindest nur mit erheblichen Einschränkungen aus dem Neuen Testament ableiten. Ja, er legt den Verdacht nahe, daß bereits die frühe Kirche an einer ganz wichtigen Stelle das Neue Testament korrigiert hat. Mit Leiturgia ist es nicht so einfach: Unser Gebrauch des Begriffes Liturgie läßt sich nicht oder zumindest nur mit erheblichen Einschränkungen aus dem Neuen Testament ableiten. Ja, er legt den Verdacht nahe, daß bereits die frühe Kirche an einer ganz wichtigen Stelle das Neue Testament korrigiert hat.
 Nur sechsmal finden wir leitourgia im Neuen Testament, das in der Septuaginta und im Judentum ohne Einschränkung für den kultischen Dienst verwendet wird. Luk 1, 23 und Hebr 9, 21 geht es um den alten Kultdienst, der sich Hebr 8,6 in Christi Opfer erfüllt: "Er hat eine höhere Liturgie empfangen, wie er ja auch der Mittler eines besseren Bundes ist". 2. Kor 9, 12 geht es wohl um die Kollekte für die verarmte Gemeinde in Jerusalem, hier steht Leiturgia ganz in der Nähe von Diakonia. Phil 2, 30 wird der Dienst des Epaphroditus für Paulus eine Liturgie genannt und Phil 2, 17 endlich der gefahrvolle Missionsdienst vom Apostel selbst als Liturgie, das heißt "Opferdienst für euren Glauben" bezeichnet. Das noch seltenere Verb leitourgein weist Röm 15, 27 nochmals auf die Kollekte für Jerusalem und Hebr 10, 11 auf den priesterlichen Opferdienst des Alten Bundes. Es gibt nur eine einzige Stelle, die in die Richtung unseres heutigen Verständnisses des Begriffes deuten könnte: Apg 13, 2 heißt es von der antiochenischen Gemeinde: "Als sie aber dem Herrn dienten (leitourgounton) und fasteten, sprach der Heilige Geist." Hier ist das kultische Verständnis des Begriffes Leiturgia spiritualisiert, es handelt sich um eine Gebetsgemeinschaft, bei der die Gemeinde Gottes Weisung empfängt. Luther hat sich gehütet, das "dem Herren dienen" mit Gottesdienst halten zu übersetzen, wie es das Neue Testament 1975 ohne Scheu tut. Nur sechsmal finden wir leitourgia im Neuen Testament, das in der Septuaginta und im Judentum ohne Einschränkung für den kultischen Dienst verwendet wird. Luk 1, 23 und Hebr 9, 21 geht es um den alten Kultdienst, der sich Hebr 8,6 in Christi Opfer erfüllt: "Er hat eine höhere Liturgie empfangen, wie er ja auch der Mittler eines besseren Bundes ist". 2. Kor 9, 12 geht es wohl um die Kollekte für die verarmte Gemeinde in Jerusalem, hier steht Leiturgia ganz in der Nähe von Diakonia. Phil 2, 30 wird der Dienst des Epaphroditus für Paulus eine Liturgie genannt und Phil 2, 17 endlich der gefahrvolle Missionsdienst vom Apostel selbst als Liturgie, das heißt "Opferdienst für euren Glauben" bezeichnet. Das noch seltenere Verb leitourgein weist Röm 15, 27 nochmals auf die Kollekte für Jerusalem und Hebr 10, 11 auf den priesterlichen Opferdienst des Alten Bundes. Es gibt nur eine einzige Stelle, die in die Richtung unseres heutigen Verständnisses des Begriffes deuten könnte: Apg 13, 2 heißt es von der antiochenischen Gemeinde: "Als sie aber dem Herrn dienten (leitourgounton) und fasteten, sprach der Heilige Geist." Hier ist das kultische Verständnis des Begriffes Leiturgia spiritualisiert, es handelt sich um eine Gebetsgemeinschaft, bei der die Gemeinde Gottes Weisung empfängt. Luther hat sich gehütet, das "dem Herren dienen" mit Gottesdienst halten zu übersetzen, wie es das Neue Testament 1975 ohne Scheu tut.
 Wenn wir auf das Neue Testament schauen, finden wir in ihm überhaupt keinen festen Terminus für das, was wir Gottesdienst nennen oder gar Liturgie im Sinne von Gottesdienstordnung: Die alten kultisch geprägten Begriffe werden geflissentlich vermieden und nur auf das Opfer Christi als die wahre "Liturgie" angewandt. Neue Begriffe sind noch nicht da, die das Einzigartige des neuen Gottesdienstes der Gemeinde des Neuen Bundes zu bezeichnen vermögen. Auf diesen Tatbestand hat Peter Brunner in seinem grundlegenden Beitrag zum Handbuch des evangelischen Gottesdienstes Leiturgia aufmerksam gemacht und den Gegenstand, um den es hier geht, mit neutestamentlicher Begrifflichkeit als "Gottesdienst der im Namen Jesu versammelten Gemeinde" umschrieben (Leiturgia I 1954, 83 ff.). Wenn wir auf das Neue Testament schauen, finden wir in ihm überhaupt keinen festen Terminus für das, was wir Gottesdienst nennen oder gar Liturgie im Sinne von Gottesdienstordnung: Die alten kultisch geprägten Begriffe werden geflissentlich vermieden und nur auf das Opfer Christi als die wahre "Liturgie" angewandt. Neue Begriffe sind noch nicht da, die das Einzigartige des neuen Gottesdienstes der Gemeinde des Neuen Bundes zu bezeichnen vermögen. Auf diesen Tatbestand hat Peter Brunner in seinem grundlegenden Beitrag zum Handbuch des evangelischen Gottesdienstes Leiturgia aufmerksam gemacht und den Gegenstand, um den es hier geht, mit neutestamentlicher Begrifflichkeit als "Gottesdienst der im Namen Jesu versammelten Gemeinde" umschrieben (Leiturgia I 1954, 83 ff.).
 Die klare Abgrenzung vom alten kultischen Opferdienst, die das Neue Testament um der Bedeutung des Opfers Christi willen vollzogen hat, konnte schon die frühe Kirche nicht durchhalten. Bleibt zunächst noch die Erinnerung wach, daß Leiturgia ursprünglich schlicht Dienst Gott und der Gemeinde gegenüber war, so führt die Herausbildung der kirchlichen Ämter bald dazu, daß für diese alttestamentliche Vorstellungen übernommen werden und der christliche Gottesdienst ganz in den Sog der alten Typologie und Tenninologie gerät. Die völlige Übertragung des alttestamentlichen Priesterbegriffes auf den Vorsitzenden der christlichen Eucharistiefeier ruft dann den reformatorischen Protest hervor und führt zur jahrhundertelangen Kirchenspaltung. Wer heute von Leiturgia theologisch verantwortlich reden will, muß deshalb den terminologischen Unterschied zum Neuen Testament offen aussprechen und eine exegetisch vertretbare Inhaltsbestimmung für seine Verwendung von Leiturgia vornehmen. Die klare Abgrenzung vom alten kultischen Opferdienst, die das Neue Testament um der Bedeutung des Opfers Christi willen vollzogen hat, konnte schon die frühe Kirche nicht durchhalten. Bleibt zunächst noch die Erinnerung wach, daß Leiturgia ursprünglich schlicht Dienst Gott und der Gemeinde gegenüber war, so führt die Herausbildung der kirchlichen Ämter bald dazu, daß für diese alttestamentliche Vorstellungen übernommen werden und der christliche Gottesdienst ganz in den Sog der alten Typologie und Tenninologie gerät. Die völlige Übertragung des alttestamentlichen Priesterbegriffes auf den Vorsitzenden der christlichen Eucharistiefeier ruft dann den reformatorischen Protest hervor und führt zur jahrhundertelangen Kirchenspaltung. Wer heute von Leiturgia theologisch verantwortlich reden will, muß deshalb den terminologischen Unterschied zum Neuen Testament offen aussprechen und eine exegetisch vertretbare Inhaltsbestimmung für seine Verwendung von Leiturgia vornehmen.
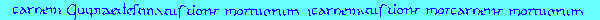
 Diakonia = Dienst ist im Neuen Testament von der Aufwartung bei Tisch und im weiteren Sinne von der Sorge für den Unterhalt bestimmt (Luk 10, 40; Apg 6, 1 ff.). Dann aber kann jeder Dienst, der aus christlicher Liebesgesinnung heraus geschieht, diakonia genannt werden, so etwa die Kollekte für Jerusalem Röm 15, 30 f., ferner alle für den Gemeindeaufbau wichtigen Tätigkeiten (1. Kor 12, 4 ff.). Röm 12, 7 wird die diakonia zwischen die prophetia und die didaskalia (= Lehre) gereiht und von Luther mit "Amt" übersetzt, was der richtigen Einschätzung des kirchlichen Amtes als Dienst entspricht. Ja, Apg 6, 4 wird sogar das Amt des Wortes als Diakonia bezeichnet: Die Zwölf sagen, sie wollen sich, nachdem die Wahl der ersten Armenpfleger angeordnet ist, dem Gebet und dieser Diakonie des Wortes widmen. Endlich wird 2. Kor 5, 18 f., in der klassischen Passage zur Begründung der kirchlichen Verkündigung, gesagt: "Gott hat uns mit sich selbst versöhnt und uns das Amt, das die Versöhnung predigt, diakonia tes katallages, gegeben." Der diakonia tou thanatou, dem Dienst, der den Tod bringt, steht 2. Kor 3, 7 bis 3, 9 die diakonia tou pneumatos gegenüber, die Diakonie, die den Geist gibt. Daß zwischen Leiturgia und Diakonia im Neuen Testament letztlich nicht eindeutig unterschieden werden kann, wird noch einmal Hebr 1, 14 deutlich: auch die Engel sind als dienstbare Geister (leitourgika pneumata) ausgesandt zur Diakonia an denen, die das Heil erben sollen. Das Verhältnis von Diakonia und Leiturgia wird am besten mit dem Bild zweier sich überschneidener Kreise dargestellt, die viel Gemeinsames, aber auch je ihr Eigenes haben. Diakonia = Dienst ist im Neuen Testament von der Aufwartung bei Tisch und im weiteren Sinne von der Sorge für den Unterhalt bestimmt (Luk 10, 40; Apg 6, 1 ff.). Dann aber kann jeder Dienst, der aus christlicher Liebesgesinnung heraus geschieht, diakonia genannt werden, so etwa die Kollekte für Jerusalem Röm 15, 30 f., ferner alle für den Gemeindeaufbau wichtigen Tätigkeiten (1. Kor 12, 4 ff.). Röm 12, 7 wird die diakonia zwischen die prophetia und die didaskalia (= Lehre) gereiht und von Luther mit "Amt" übersetzt, was der richtigen Einschätzung des kirchlichen Amtes als Dienst entspricht. Ja, Apg 6, 4 wird sogar das Amt des Wortes als Diakonia bezeichnet: Die Zwölf sagen, sie wollen sich, nachdem die Wahl der ersten Armenpfleger angeordnet ist, dem Gebet und dieser Diakonie des Wortes widmen. Endlich wird 2. Kor 5, 18 f., in der klassischen Passage zur Begründung der kirchlichen Verkündigung, gesagt: "Gott hat uns mit sich selbst versöhnt und uns das Amt, das die Versöhnung predigt, diakonia tes katallages, gegeben." Der diakonia tou thanatou, dem Dienst, der den Tod bringt, steht 2. Kor 3, 7 bis 3, 9 die diakonia tou pneumatos gegenüber, die Diakonie, die den Geist gibt. Daß zwischen Leiturgia und Diakonia im Neuen Testament letztlich nicht eindeutig unterschieden werden kann, wird noch einmal Hebr 1, 14 deutlich: auch die Engel sind als dienstbare Geister (leitourgika pneumata) ausgesandt zur Diakonia an denen, die das Heil erben sollen. Das Verhältnis von Diakonia und Leiturgia wird am besten mit dem Bild zweier sich überschneidener Kreise dargestellt, die viel Gemeinsames, aber auch je ihr Eigenes haben.
 Nach dem Blick auf den neutestamentlichen Befund kommen wir zu der entscheidenden Frage: Ist die Trias Martyria - Leiturgia - Diakonia geeignet, den kirchlichen Auftrag und das kirchliche Leben zureichend zu beschreiben? Auch wenn wir für Leiturgia noch keinen dem neutestamentlichen Sprachgebrauch besser entsprechenden und vor Mißdeutungen geschützten Begriff gefunden haben, kann diese Frage grundsätzlich bejaht und dies mit drei Überlegungen begründet werden. Nach dem Blick auf den neutestamentlichen Befund kommen wir zu der entscheidenden Frage: Ist die Trias Martyria - Leiturgia - Diakonia geeignet, den kirchlichen Auftrag und das kirchliche Leben zureichend zu beschreiben? Auch wenn wir für Leiturgia noch keinen dem neutestamentlichen Sprachgebrauch besser entsprechenden und vor Mißdeutungen geschützten Begriff gefunden haben, kann diese Frage grundsätzlich bejaht und dies mit drei Überlegungen begründet werden.
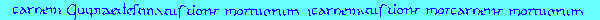
Unser heutiges Verständnis von Liturgie
 Die Tatsache, daß uns die Abgrenzung von Leiturgia und Diakonia schwerfällt, darf auch positiv gewertet werden: Beide gehören wesensgemäß zusammen und machen einander erst möglich. Zugleich können sie beide nicht der Martyria entbehren, aus der Glaube entsteht und die uns in die Christuswirklichkeit hineinzieht. So kann man von dem einen nicht ohne die beiden anderen reden. Die Tatsache, daß uns die Abgrenzung von Leiturgia und Diakonia schwerfällt, darf auch positiv gewertet werden: Beide gehören wesensgemäß zusammen und machen einander erst möglich. Zugleich können sie beide nicht der Martyria entbehren, aus der Glaube entsteht und die uns in die Christuswirklichkeit hineinzieht. So kann man von dem einen nicht ohne die beiden anderen reden.
 Wenn wir den Begriff Liturgie positiv aufnehmen, dann geht es um den Gottesdienst, der nach reformatorischer Erkenntnis nicht auf die gemein same Feierstunde begrenzt bleiben kann, sondern übergehen muß in den Gottesdienst des alltäglichen Lebens. Die Nähe von Leiturgia zur Diakonia erinnert uns daran. Allerdings ist der Gottesdienst des Alltags nicht einfach auf die Menschen ausgerichtetes Christentum der Tat. Gottesdienst bleibt in einem vitalen Sinne doppeldeutig: Er ist zuerst Gottes Dienst an uns und - dadurch ermöglicht - unser Dienst Gott gegenüber im Gotteslob, der Eucharistia, und in der Hinwendung zum anderen. Das Christuswort Matth 25, 40 "Was ihr getan habt einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan" bildet die Klammer. Will man einen ausschließlich auf die Feier der im Namen Jesu versammelten Gemeinde begrenzten Begriff, so bietet sich etwa das englische Wort worship an, das dann als Lehnwort aufgenommen weden müßte. Wenn wir den Begriff Liturgie positiv aufnehmen, dann geht es um den Gottesdienst, der nach reformatorischer Erkenntnis nicht auf die gemein same Feierstunde begrenzt bleiben kann, sondern übergehen muß in den Gottesdienst des alltäglichen Lebens. Die Nähe von Leiturgia zur Diakonia erinnert uns daran. Allerdings ist der Gottesdienst des Alltags nicht einfach auf die Menschen ausgerichtetes Christentum der Tat. Gottesdienst bleibt in einem vitalen Sinne doppeldeutig: Er ist zuerst Gottes Dienst an uns und - dadurch ermöglicht - unser Dienst Gott gegenüber im Gotteslob, der Eucharistia, und in der Hinwendung zum anderen. Das Christuswort Matth 25, 40 "Was ihr getan habt einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan" bildet die Klammer. Will man einen ausschließlich auf die Feier der im Namen Jesu versammelten Gemeinde begrenzten Begriff, so bietet sich etwa das englische Wort worship an, das dann als Lehnwort aufgenommen weden müßte.
 Wenn wir das "liturgische" Geschehen des Gottesdienstes untersuchen, so stoßen wir bald auf die der Reformation so verdächtige Rede vom Opfer. Sie ist aber ihrer Herkunft nach nicht einfach ein Rückfall in alttestamentlichkultisches Denken, sondern geschichtlich aus einem alten, besonders in der lateinischen Tradition ausgeprägten liturgischen Formgesetz zu erklären, nach dem die Sprache der Liturgie den in ihr vollzogenen Vorgang gern deutend aufnimmt. Wenn Christus in seiner Person und seinem Opfer für uns in der Eucharistiefeier wirklich gegenwärtig ist, dann redet auch die Liturgie von einer Darbringung, ohne daß je die sogenannte unblutige Wiederholung des Kreuzopfers ein ernsthaftes Theologoumenon werden mußte und geworden ist: "Wir bringen dir dar" bedeutet nicht, daß zum Kreuzesopfer Christi ein neues Opfer der Gemeinde oder des Priesters hinzukommen müßte, sondem ganz schlicht, daß wir Christus bei seinem Wort nehmen und tun, was er uns geboten hat. Gerade in dieser Wendung kommt, historisch gesehen, zum Ausdruck, daß Christus selbst der Liturg unserer Eucharistie ist. In der Beschränkung auf das unbedingt Notwendige ist nun andererseits in der nachreformatorischen Tradition ein Formprinzip zur Herrschaft gekommen, mit dem vor lauter Ängstlichkeit, der Mensch könne zuviel tun und damit die Souveränität des Handeln Gottes antasten, die Unbefangenheit des Gotteslobes verlorengegangen ist: Minimalliturgie und Predigthypertrophie haben den evangelischen Christen weithin gottesdienstlich unbehaust werden lassen. Solange lokale Sitte und Gottesdienst als Treffpunkt der Gemeinde ohne die Konkurrenz der Medien und der Mobilität blieben, war dieser Mangel vielen verborgen. Jetzt aber ist die Auswanderung großer Teile der Gemeinde aus der gotIesdInstlichen Praxis als fast zwangsläufige Folge des Mangels an kqmmunikativen Elementen im Gottesdienst unübersehbar. Wenn das Interesse ganz auf die Predigt und den Prediger fixiert ist wird die Unentrinnbarkeit der liturgischen Gestalt übersehen, die der Gemeinde zur korporativen Feier und zur Festfreude verhelfen soll. Wenn der Blick nur mehr auf die Elemente des Abendmahls fällt, geht der aus der großen jüdischen berakah-Tradition stammende Eucharistie-Charakter verloren, zu dem die Christen wegen des zentralen neuen Inhalts Jesus Christus besonderen Zugang finden sollten. Wenn wir das "liturgische" Geschehen des Gottesdienstes untersuchen, so stoßen wir bald auf die der Reformation so verdächtige Rede vom Opfer. Sie ist aber ihrer Herkunft nach nicht einfach ein Rückfall in alttestamentlichkultisches Denken, sondern geschichtlich aus einem alten, besonders in der lateinischen Tradition ausgeprägten liturgischen Formgesetz zu erklären, nach dem die Sprache der Liturgie den in ihr vollzogenen Vorgang gern deutend aufnimmt. Wenn Christus in seiner Person und seinem Opfer für uns in der Eucharistiefeier wirklich gegenwärtig ist, dann redet auch die Liturgie von einer Darbringung, ohne daß je die sogenannte unblutige Wiederholung des Kreuzopfers ein ernsthaftes Theologoumenon werden mußte und geworden ist: "Wir bringen dir dar" bedeutet nicht, daß zum Kreuzesopfer Christi ein neues Opfer der Gemeinde oder des Priesters hinzukommen müßte, sondem ganz schlicht, daß wir Christus bei seinem Wort nehmen und tun, was er uns geboten hat. Gerade in dieser Wendung kommt, historisch gesehen, zum Ausdruck, daß Christus selbst der Liturg unserer Eucharistie ist. In der Beschränkung auf das unbedingt Notwendige ist nun andererseits in der nachreformatorischen Tradition ein Formprinzip zur Herrschaft gekommen, mit dem vor lauter Ängstlichkeit, der Mensch könne zuviel tun und damit die Souveränität des Handeln Gottes antasten, die Unbefangenheit des Gotteslobes verlorengegangen ist: Minimalliturgie und Predigthypertrophie haben den evangelischen Christen weithin gottesdienstlich unbehaust werden lassen. Solange lokale Sitte und Gottesdienst als Treffpunkt der Gemeinde ohne die Konkurrenz der Medien und der Mobilität blieben, war dieser Mangel vielen verborgen. Jetzt aber ist die Auswanderung großer Teile der Gemeinde aus der gotIesdInstlichen Praxis als fast zwangsläufige Folge des Mangels an kqmmunikativen Elementen im Gottesdienst unübersehbar. Wenn das Interesse ganz auf die Predigt und den Prediger fixiert ist wird die Unentrinnbarkeit der liturgischen Gestalt übersehen, die der Gemeinde zur korporativen Feier und zur Festfreude verhelfen soll. Wenn der Blick nur mehr auf die Elemente des Abendmahls fällt, geht der aus der großen jüdischen berakah-Tradition stammende Eucharistie-Charakter verloren, zu dem die Christen wegen des zentralen neuen Inhalts Jesus Christus besonderen Zugang finden sollten.
 All die verschiedenen Bezeichnungen für den Gottesdienst besagen, daß die Gemeinde ihre Lebensmitte in der Begegnung mit Gott durch Wort und Sakrament in der gemeinsamen Feier hat, ob der Gottesdienst nun Liturgie genannt wird, wie in der Ostkirche, oder Dienst, wie in der katholisch-apostolischen Tradition, oder Eucharistie, wie in der römischen Kirche anstelle des bis heute noch nicht recht geklärten Begriffes Messe. Die Bezeichnung Eucharistie wird nun auch im evangelischen Raum zunehmend gebräuchlich und empfiehlt sich besonders, da sie als einzige ihre Herleitung neutestamentlich begründet, sogar irn Wortlaut des Einsetzungsberichtes. Karl Bernhard Ritter brachte diese Mitte der Gemeinde schon 1946 in einer kleinen Schrift "Die Liturgie als Lebensform der Kirche" in die Diskussion neu ein. Man wird diese Mitte der Gemeinde aber weniger als ein Formprinzip, sondern mehr als ein in großer Manigfaltigkeit sich darstellendes und erfahrbares Lebenszentrum der Gemeinde verstehen müssen. Insofern hat Christhard Mahrenholz recht, wenn er in seinem Geleitwort zur Leiturgia I betont, daß es in diesem Handbuch des evangelischen Gottesdienstes "nicht um die 'Liturgie' im landläufigen Sinne, sondern um den 'Dienst', nämlich den Gottesdienst der im Namen Jesu Christi versammelten Gemeinde" geht. Von dieser Mitte aus haben wir nun den Brückenschlag zu den beiden anderen unaufgebbaren Hauptstücken des Berufes der Kirche zu suchen. All die verschiedenen Bezeichnungen für den Gottesdienst besagen, daß die Gemeinde ihre Lebensmitte in der Begegnung mit Gott durch Wort und Sakrament in der gemeinsamen Feier hat, ob der Gottesdienst nun Liturgie genannt wird, wie in der Ostkirche, oder Dienst, wie in der katholisch-apostolischen Tradition, oder Eucharistie, wie in der römischen Kirche anstelle des bis heute noch nicht recht geklärten Begriffes Messe. Die Bezeichnung Eucharistie wird nun auch im evangelischen Raum zunehmend gebräuchlich und empfiehlt sich besonders, da sie als einzige ihre Herleitung neutestamentlich begründet, sogar irn Wortlaut des Einsetzungsberichtes. Karl Bernhard Ritter brachte diese Mitte der Gemeinde schon 1946 in einer kleinen Schrift "Die Liturgie als Lebensform der Kirche" in die Diskussion neu ein. Man wird diese Mitte der Gemeinde aber weniger als ein Formprinzip, sondern mehr als ein in großer Manigfaltigkeit sich darstellendes und erfahrbares Lebenszentrum der Gemeinde verstehen müssen. Insofern hat Christhard Mahrenholz recht, wenn er in seinem Geleitwort zur Leiturgia I betont, daß es in diesem Handbuch des evangelischen Gottesdienstes "nicht um die 'Liturgie' im landläufigen Sinne, sondern um den 'Dienst', nämlich den Gottesdienst der im Namen Jesu Christi versammelten Gemeinde" geht. Von dieser Mitte aus haben wir nun den Brückenschlag zu den beiden anderen unaufgebbaren Hauptstücken des Berufes der Kirche zu suchen.
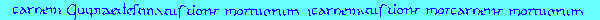
Leiturgia und Martyria
 Wenn Gottesdienst in erster Linie Gottes Dienst an uns ist, der durch sein Wort und Sakrament geschieht, dann ist in der Leiturgia immer schon notwendigerweise die Martyria eingeschlossen. Wir sind uns heute klar darüber, daß die Martyria zwar hauptsächlich, aber keineswegs ausschließlich in der frei formulierten Predigt zu Gehör kommt. Die Schriftlesung, der betende Umgang mit Gottes Wort vor allem in den Psalmen und das Hörbarwerden der verba ipsissima sind konstitutive Verkündigungselemente jeder Liturgie. Wie es sicher ein Mißbrauch ist, wenn die freie Wortverkündigung nur mehr zu einer kurzen Einleitung eines musikalisch reichen Rundfunkgottesdienstes gerät, so ist die ausführliche Predigt mit flüchtig hingeworfener Umrahmung durch Gesang und Gebet ein unzumutbarer Mißbrauch. Wenn Gottesdienst in erster Linie Gottes Dienst an uns ist, der durch sein Wort und Sakrament geschieht, dann ist in der Leiturgia immer schon notwendigerweise die Martyria eingeschlossen. Wir sind uns heute klar darüber, daß die Martyria zwar hauptsächlich, aber keineswegs ausschließlich in der frei formulierten Predigt zu Gehör kommt. Die Schriftlesung, der betende Umgang mit Gottes Wort vor allem in den Psalmen und das Hörbarwerden der verba ipsissima sind konstitutive Verkündigungselemente jeder Liturgie. Wie es sicher ein Mißbrauch ist, wenn die freie Wortverkündigung nur mehr zu einer kurzen Einleitung eines musikalisch reichen Rundfunkgottesdienstes gerät, so ist die ausführliche Predigt mit flüchtig hingeworfener Umrahmung durch Gesang und Gebet ein unzumutbarer Mißbrauch.
 Der reine protestantische Predigtgottesdienst ist in der neueren Forschung als bedenkliche Verarmung der Gemeinde in ihrer Lebensmitte entlarvt worden. Werner Jetter hat in seinem Buch "Symbol und Ritual" (1978) aufgezeigt, daß.eben dieser vermeintlich kultfreie protestantische Predigtgottesdienst selber Ritual ist, nur meist ein schlechtes. Alles Gemeinschaftsleben, alle Begegnungen und gemeinsamen Handlungen haben ihre Symbole und Rituale, auch der Gottesdienst der feiernden Gemeinde. Der reine protestantische Predigtgottesdienst ist in der neueren Forschung als bedenkliche Verarmung der Gemeinde in ihrer Lebensmitte entlarvt worden. Werner Jetter hat in seinem Buch "Symbol und Ritual" (1978) aufgezeigt, daß.eben dieser vermeintlich kultfreie protestantische Predigtgottesdienst selber Ritual ist, nur meist ein schlechtes. Alles Gemeinschaftsleben, alle Begegnungen und gemeinsamen Handlungen haben ihre Symbole und Rituale, auch der Gottesdienst der feiernden Gemeinde.
 Der innige Zusammenhang zwischen liturgischem Geschehen und Verkündigung und dann auch die notwendige Einbeziehung des Herrenmahles in jeden Hauptgottesdienst am Sonntag wird in der lutherischen Tradition offenkundig, wenn Martin Luther schreibt, daß jede Predigt eine "vorklerung der wort Christi, da er sagt und die meß einsetzt, das ist mein leib, das ist mein blut" sein soll, denn "Was ist das gantz Euangelium anders, den ein vorklerung dieses testaments?" (Sermon vom Neuen Testament 1520). Es ist für die alte Kirche unvorstellbar, daß nicht jeden Sonntag die Eucharistie gefeiert wird und jedes Gemeindeglied kommuniziert, es sei denn, besondere Gründe lägen vor. Uns sind die Zerstörungen bekannt, die Rationalismus und Individualismus im evangelischen Gottesdienst angerichtet haben. Aus der Gemeinde wurde ein Predigtpublikum, aus dem Prediger ein Kanzelredner. Deshalb fehlt bei sehr vielen das Verständnis für die korporative und kommunikative Dimension des Gottesdienstes. Deshalb sind die Predigten so oft bei aller theologischen Richtigkeit oder auch Aufmümpfigkeit abstrakt und lebensfern; sie erwachsen nicht aus betendem Umgang mit der Schrift und gemeinsamem Leben vor Gott. Der innige Zusammenhang zwischen liturgischem Geschehen und Verkündigung und dann auch die notwendige Einbeziehung des Herrenmahles in jeden Hauptgottesdienst am Sonntag wird in der lutherischen Tradition offenkundig, wenn Martin Luther schreibt, daß jede Predigt eine "vorklerung der wort Christi, da er sagt und die meß einsetzt, das ist mein leib, das ist mein blut" sein soll, denn "Was ist das gantz Euangelium anders, den ein vorklerung dieses testaments?" (Sermon vom Neuen Testament 1520). Es ist für die alte Kirche unvorstellbar, daß nicht jeden Sonntag die Eucharistie gefeiert wird und jedes Gemeindeglied kommuniziert, es sei denn, besondere Gründe lägen vor. Uns sind die Zerstörungen bekannt, die Rationalismus und Individualismus im evangelischen Gottesdienst angerichtet haben. Aus der Gemeinde wurde ein Predigtpublikum, aus dem Prediger ein Kanzelredner. Deshalb fehlt bei sehr vielen das Verständnis für die korporative und kommunikative Dimension des Gottesdienstes. Deshalb sind die Predigten so oft bei aller theologischen Richtigkeit oder auch Aufmümpfigkeit abstrakt und lebensfern; sie erwachsen nicht aus betendem Umgang mit der Schrift und gemeinsamem Leben vor Gott.
 Wir halten fest: Ohne Martyria ist der Gottesdienst seiner Lebensquelle beraubt, ohne Leiturgia die Verkündigung ihrer begründenden und zielweisenden Legitimation. Wir halten fest: Ohne Martyria ist der Gottesdienst seiner Lebensquelle beraubt, ohne Leiturgia die Verkündigung ihrer begründenden und zielweisenden Legitimation.
 Nun gibt es einen Bereich, in dem das Auseinandertreten von Leiturgia und Martyria berechtigt zu sein scheint: die missionarische Predigt. Es hat in der Geschichte der Kirche eine Periode gegeben, in der sehr streng zwischen dem innergemeindlichen und dem missionarischen Wort unterschieden wurde. Ganz gewiß hat auch Paulus auf dem Areopag von seiner Predigt, "Nun verkündige ich euch diesen Gott, den ihr unwissend verehrt" (Apg 17, 22), nicht zur Feier des Gemeindegottesdienstes übergehen können. Durch die weitgehende Entkirchlichung vieler getaufter Christen und Gemeinden scheint sich das Problem in neuer Weise zu stellen. Aber das Auseinandertreten ist nur ein scheinbares: Die missionarische Verkündigung zielt auf die Taufe und Eingliederung in die gottesdienstliche Gemeinde. Und dann bleibt der Gerneindegottesdienst nicht in einem hermetisch abgeschlossenen Raum: Die Tatsache, daß die christliche Gemeinde ihren Gottesdienst feiert, ist selbst und gerade in einer atheistischen Umgebung ein Politikum ersten Ranges. Auf der einen Seite steht die Verwunderung der Heiden über das Gemeindeleben der Christen: "Seht, wie sie einander lieben!" (nach Tertullian, Apologeticum, um 200), auf der anderen werden Christen bis heute um ihres Glauben willen verfolgt und die Feier des Gottesdienstes als eine untragbare Zumutung für die atheistische Gesellschaft empfunden. Warum Unterdrückung und Verfolgung, wenn die Sache der Christen doch eigentlich schon längst durch die Geschichte überholt ist? Der Gottesdienst, selbst der im Verborgenen gefeierte, ist eine Proklamation der Herrschaft Christi und damit eine Herausforderung der Mächte dieser Welt. Nun gibt es einen Bereich, in dem das Auseinandertreten von Leiturgia und Martyria berechtigt zu sein scheint: die missionarische Predigt. Es hat in der Geschichte der Kirche eine Periode gegeben, in der sehr streng zwischen dem innergemeindlichen und dem missionarischen Wort unterschieden wurde. Ganz gewiß hat auch Paulus auf dem Areopag von seiner Predigt, "Nun verkündige ich euch diesen Gott, den ihr unwissend verehrt" (Apg 17, 22), nicht zur Feier des Gemeindegottesdienstes übergehen können. Durch die weitgehende Entkirchlichung vieler getaufter Christen und Gemeinden scheint sich das Problem in neuer Weise zu stellen. Aber das Auseinandertreten ist nur ein scheinbares: Die missionarische Verkündigung zielt auf die Taufe und Eingliederung in die gottesdienstliche Gemeinde. Und dann bleibt der Gerneindegottesdienst nicht in einem hermetisch abgeschlossenen Raum: Die Tatsache, daß die christliche Gemeinde ihren Gottesdienst feiert, ist selbst und gerade in einer atheistischen Umgebung ein Politikum ersten Ranges. Auf der einen Seite steht die Verwunderung der Heiden über das Gemeindeleben der Christen: "Seht, wie sie einander lieben!" (nach Tertullian, Apologeticum, um 200), auf der anderen werden Christen bis heute um ihres Glauben willen verfolgt und die Feier des Gottesdienstes als eine untragbare Zumutung für die atheistische Gesellschaft empfunden. Warum Unterdrückung und Verfolgung, wenn die Sache der Christen doch eigentlich schon längst durch die Geschichte überholt ist? Der Gottesdienst, selbst der im Verborgenen gefeierte, ist eine Proklamation der Herrschaft Christi und damit eine Herausforderung der Mächte dieser Welt.
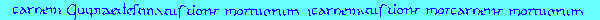
Leiturgia und Diakonia
 Wenn wir nun den Brückenschlag von der Leiturgia als der Lebensmitte der Gemeinde aus zur tätigen Liebe im Alltag, zur Diakonia suchen, stehen wir vor der Frage: Gibt es nicht auch eine Verkündigung durch eine entsprechende Lebenshaltung der Christen, durch ihr Sosein und So-Gewordensein ohne proklamierende Worte? Der Weltbezug des christlichen Glaubens und der Weltumgang der Christen ist eine berechtigte Forderung gerade unserer Zeit. Seit der Konferenz über Kirche und Gesellschaft in Genf 1967 ist die ökumenische Diskussion beherrscht durch Themen wie Einheit der Menschheit, Friedenssicherung, Schaffung gerechter Strukturen, Kampf gegen jede Form des Rassismus und anderes. Dieser Einsatz kann nach reformatorischer Auffassung sehr wohl auch als Gottesdienst verstanden werden. Gottesdienst ohne wortgebundene Verkündigung und ausgeführte Liturgie gibt es und muß es geben schon deshalb, weil die christliche Gemeinde nicht in einer Enklave lebt, sondern mitten in dieser Welt, und weil Christus ihr Verhalten durch die Liebe zu Gott und zum Nächsten bestimmt hat. Wenn wir nun den Brückenschlag von der Leiturgia als der Lebensmitte der Gemeinde aus zur tätigen Liebe im Alltag, zur Diakonia suchen, stehen wir vor der Frage: Gibt es nicht auch eine Verkündigung durch eine entsprechende Lebenshaltung der Christen, durch ihr Sosein und So-Gewordensein ohne proklamierende Worte? Der Weltbezug des christlichen Glaubens und der Weltumgang der Christen ist eine berechtigte Forderung gerade unserer Zeit. Seit der Konferenz über Kirche und Gesellschaft in Genf 1967 ist die ökumenische Diskussion beherrscht durch Themen wie Einheit der Menschheit, Friedenssicherung, Schaffung gerechter Strukturen, Kampf gegen jede Form des Rassismus und anderes. Dieser Einsatz kann nach reformatorischer Auffassung sehr wohl auch als Gottesdienst verstanden werden. Gottesdienst ohne wortgebundene Verkündigung und ausgeführte Liturgie gibt es und muß es geben schon deshalb, weil die christliche Gemeinde nicht in einer Enklave lebt, sondern mitten in dieser Welt, und weil Christus ihr Verhalten durch die Liebe zu Gott und zum Nächsten bestimmt hat.
 Jetzt taucht aber das schwierige Problem auf: Müßte nicht der Christ bei aller inneren Verbundenheit und sachlichen Zusammenarbeit mit allen "Menschen guten Willens" und damit die christliche Gemeinde in ihrer Diakonia ein Proprium haben, das unverkennbar auf das Fundament des christlichen Glaubens hinweist? Diese Frage ist besonders der Anstaltsdiakonie vertraut. Unser Problem ist deshalb nicht nur "Gibt es eine Diakonie ohne Liturgie?", sondern auch "Gibt es eine Diakonie ohne Verkündigung?" Jetzt taucht aber das schwierige Problem auf: Müßte nicht der Christ bei aller inneren Verbundenheit und sachlichen Zusammenarbeit mit allen "Menschen guten Willens" und damit die christliche Gemeinde in ihrer Diakonia ein Proprium haben, das unverkennbar auf das Fundament des christlichen Glaubens hinweist? Diese Frage ist besonders der Anstaltsdiakonie vertraut. Unser Problem ist deshalb nicht nur "Gibt es eine Diakonie ohne Liturgie?", sondern auch "Gibt es eine Diakonie ohne Verkündigung?"
 Mancherorts sehen wir auch in unserer Kirche Bestrebungen am Werke, die den diakonischen Auftrag - an den Randgruppen unserer Gesellschaft, im politischen Raum und im Weltmaßstab - gänzlich von der Verkündigung und der Liturgie trennen möchten. Wo dies aber geschieht, ist die Einheit des christlichen Lebens zerbrochen und wird unweigerlich der Glaube schwinden. Man kann das an einzelnen radikalen Vertretern dieser These deutlich beobachten. Diakonia und Leiturgia gehören untrennbar zusammen, die Diakonie ist ebenso wie die Seelsorge immer auch ein Stück Verkündigung. Aus der modernen Seelsorgediskussion kann der Beweis für unsere These vielleicht am überzeugendsten angetreten werden, zumal Seelsorge und Diakonie unbestreitbar eng miteinander verflochten sind. Es gab eine Zeit, in der man Seelsorge nur als Einzelseelsorge und darin als Verkündigungsgeschehen verstand: Eingehen auf das Gegenüber, Bruch im Gespräch und zur Sache Kommen, Ausrichten des Evangeliums vor allem in der Absolution waren die wichtigsten Merkmale. Gegen diese Theorie stellt sich die partnerzentrierte Seelsorge, die von Annehmen (auch des Anstößigen) und Begleiten, von empathischer Einfühlung bestimmt ist. Heute wird deutlich, daß beide Theorien ihr Recht haben und ergänzungsbedürftig sind. Können wir den Ratsuchenden nur anpredigen, ohne auf seine psychische Situation einzugehen? Können wir aber auch auf die Situation eingehen, ohne den Trost des Evangeliums auszurichten? Es wird deshalb in Zukunft kaum um eine Alternative gehen, sondern um eine Kombination, in der sowohl die Menschenkenntnis und therapeutischen Möglichkeiten der Psychologie im weitesten Sinne zur Hilfe genommen werden, als auch der Mensch in seiner Bedürftigkeit, der die Psychologie allein nicht gerecht werden kann, gesehen wird. Sinnfragen, Geborgenheit, Transzendenz und neue Strukturen der Gerneinschaft sind zentrale Themen künftiger Seelsorgetheorie. Mancherorts sehen wir auch in unserer Kirche Bestrebungen am Werke, die den diakonischen Auftrag - an den Randgruppen unserer Gesellschaft, im politischen Raum und im Weltmaßstab - gänzlich von der Verkündigung und der Liturgie trennen möchten. Wo dies aber geschieht, ist die Einheit des christlichen Lebens zerbrochen und wird unweigerlich der Glaube schwinden. Man kann das an einzelnen radikalen Vertretern dieser These deutlich beobachten. Diakonia und Leiturgia gehören untrennbar zusammen, die Diakonie ist ebenso wie die Seelsorge immer auch ein Stück Verkündigung. Aus der modernen Seelsorgediskussion kann der Beweis für unsere These vielleicht am überzeugendsten angetreten werden, zumal Seelsorge und Diakonie unbestreitbar eng miteinander verflochten sind. Es gab eine Zeit, in der man Seelsorge nur als Einzelseelsorge und darin als Verkündigungsgeschehen verstand: Eingehen auf das Gegenüber, Bruch im Gespräch und zur Sache Kommen, Ausrichten des Evangeliums vor allem in der Absolution waren die wichtigsten Merkmale. Gegen diese Theorie stellt sich die partnerzentrierte Seelsorge, die von Annehmen (auch des Anstößigen) und Begleiten, von empathischer Einfühlung bestimmt ist. Heute wird deutlich, daß beide Theorien ihr Recht haben und ergänzungsbedürftig sind. Können wir den Ratsuchenden nur anpredigen, ohne auf seine psychische Situation einzugehen? Können wir aber auch auf die Situation eingehen, ohne den Trost des Evangeliums auszurichten? Es wird deshalb in Zukunft kaum um eine Alternative gehen, sondern um eine Kombination, in der sowohl die Menschenkenntnis und therapeutischen Möglichkeiten der Psychologie im weitesten Sinne zur Hilfe genommen werden, als auch der Mensch in seiner Bedürftigkeit, der die Psychologie allein nicht gerecht werden kann, gesehen wird. Sinnfragen, Geborgenheit, Transzendenz und neue Strukturen der Gerneinschaft sind zentrale Themen künftiger Seelsorgetheorie.
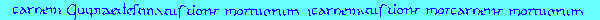
 Was bedeutet das nun für die Diakonie der Gemeinde, die Anstaltsdiakonie, aber auch die politische Diakonie der Kirche? Sie kann dem Menschen nicht genug helfen, wenn sie allein Leibsorge und psychische Versorgung im Auge hat. Wie gegen die Flut des theoretischen wie des praktischen Atheismus nicht die Verbindung mit allen anderen Religionen zur gemeinsamen Rettung des Religiösen helfen kann, so stellt sich auch hier die Frage nach dem Auftrag und der Wahrheit. Und die wird nur im Zusammenschauen von Heilung und Heil bzw. Wohl und Heil beantwortet: Heilung ist immer nur ein Zeichen, das auf das Heil hindeutet. Was bedeutet das nun für die Diakonie der Gemeinde, die Anstaltsdiakonie, aber auch die politische Diakonie der Kirche? Sie kann dem Menschen nicht genug helfen, wenn sie allein Leibsorge und psychische Versorgung im Auge hat. Wie gegen die Flut des theoretischen wie des praktischen Atheismus nicht die Verbindung mit allen anderen Religionen zur gemeinsamen Rettung des Religiösen helfen kann, so stellt sich auch hier die Frage nach dem Auftrag und der Wahrheit. Und die wird nur im Zusammenschauen von Heilung und Heil bzw. Wohl und Heil beantwortet: Heilung ist immer nur ein Zeichen, das auf das Heil hindeutet.
 Deshalb bedarf die Diakonia in allen ihren Formen der wesensgemäßen Verbindung zur Leiturgia, deshalb ist das benediktinische "ora et labora" das Motto aller Diakonie. Diakonia ist Zeichen der Lebendigkeit des Glaubens, der mehr und tiefer in die Not der Menschen eindringt als der Unglaube. Auf dieser Basis ist die kirchliche Diakonie in immer neue Räume vorgestoßen, hat Verlorenes entdeckt und heimzubringen gesucht. Schulen, Krankenhäuser, Pflegeheime sind so gegründet worden, Hilfs- und Entwicklungsprogramme aufgestellt, Gewissensbildungsprozesse eingeleitet und die öffentliche Hand auf ihre Verantwortung hingewiesen. Die Gemeinde wird weder ausruhen dürfen noch die gesamte Sozialarbet an sich ziehen müssen. Wenn Staat und Gesellschaft einen Notstand erkannt und Schritte zu dessen Beseitigung unternommen haben, wird diakonischer Dienst auch außerhalb der kirchlichen Diakonie durch Christen getan werden können. Die Gemeinde aber ist berufen, mit ihrer ganzen Kraft vorzustoßen zu den Menschen, die heute der Hilfe bedürfen und für die sonst niemand da ist. Deshalb bedarf die Diakonia in allen ihren Formen der wesensgemäßen Verbindung zur Leiturgia, deshalb ist das benediktinische "ora et labora" das Motto aller Diakonie. Diakonia ist Zeichen der Lebendigkeit des Glaubens, der mehr und tiefer in die Not der Menschen eindringt als der Unglaube. Auf dieser Basis ist die kirchliche Diakonie in immer neue Räume vorgestoßen, hat Verlorenes entdeckt und heimzubringen gesucht. Schulen, Krankenhäuser, Pflegeheime sind so gegründet worden, Hilfs- und Entwicklungsprogramme aufgestellt, Gewissensbildungsprozesse eingeleitet und die öffentliche Hand auf ihre Verantwortung hingewiesen. Die Gemeinde wird weder ausruhen dürfen noch die gesamte Sozialarbet an sich ziehen müssen. Wenn Staat und Gesellschaft einen Notstand erkannt und Schritte zu dessen Beseitigung unternommen haben, wird diakonischer Dienst auch außerhalb der kirchlichen Diakonie durch Christen getan werden können. Die Gemeinde aber ist berufen, mit ihrer ganzen Kraft vorzustoßen zu den Menschen, die heute der Hilfe bedürfen und für die sonst niemand da ist.
 Von ihrer Geschichte her ist die kirchliche Diakonie aus dem Hören auf das Wort des Herrn entstanden und mit der gemeinsamen Hinwendung aller in ihr Tätigen zu diesem Herrn im Gottesdienst zur Entfaltung gekommen. Ihre Zukunft liegt in ihrem Aufbruch schon begründet: Sie hängt daran, daß die Diakonia mit der Leiturgia wie mit der Martyria aufs innigste verbunden bleibt und so die dreifaltige Einigkeit alles kirchlichen Denkens und Handelns glaubwürdig gelebt wird. Wo eines gegen das andere ausgespielt wird, geht alles verloren. Wo wir aber müde und zaghaft werden, wird uns die Konzentration auf den Gottesdienst neue Vollmacht geben zum Brückenschlag zur Martyria und zur Diakonia. Von ihrer Geschichte her ist die kirchliche Diakonie aus dem Hören auf das Wort des Herrn entstanden und mit der gemeinsamen Hinwendung aller in ihr Tätigen zu diesem Herrn im Gottesdienst zur Entfaltung gekommen. Ihre Zukunft liegt in ihrem Aufbruch schon begründet: Sie hängt daran, daß die Diakonia mit der Leiturgia wie mit der Martyria aufs innigste verbunden bleibt und so die dreifaltige Einigkeit alles kirchlichen Denkens und Handelns glaubwürdig gelebt wird. Wo eines gegen das andere ausgespielt wird, geht alles verloren. Wo wir aber müde und zaghaft werden, wird uns die Konzentration auf den Gottesdienst neue Vollmacht geben zum Brückenschlag zur Martyria und zur Diakonia.
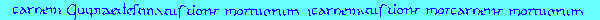
 Es wäre reizvoll, die eingangs angedeutete Erweiterung unserer triadischen Formel durch den Begriff Koinonia zu versuchen. Wir kennen ihn aus dem Apostolikum, dort aber in der mißverständlichen Übersetzung Gemeinschaft (der Heiligen), als ob die eben erst gemachte Aussage über die Kirche noch einmal wiederholt werden müsse. Koinonia heißt Teilhabe am Heiligen, nämlich durch den Geist am Leib des erhöhten Herrn, in den sein Leib, die Kirche, nun eingegliedert ist. Koinonia markiert also die Beziehung des erhöhten Herrn zu seiner Gemeinde, die sich in der eucharistischen Mahlzeit vollzieht und deshalb notwendigerweise die Teilhabe der Gemeinde einschließt. Genau in diesem Sinne als Teilhabe an Christus und Teilhabe untereinander versteht Luther Koinonia, die deshalb nicht als Körperschaft oder Genossenschaft (societas) gedeutet und als Parallele zu Ekklesia/ Kirche gebraucht werden darf. Mit der Wiedergewinnung des Koinonia-Aspektes findet die gottesdienstliche Gemeinde aus der Einengung des Blickes auf individuelle Sündenvergebung, auf die Gültigkeit, auf die Sicherung der Realpräsenz und auf die Elemente heraus, die in beiden Kirchen die Gabe Christi verdunkelt, sie findet ihren Wesenszug ab empfangende und gebende Gemeinschaft und damit auch die eminent soziale Komponente des Gottesdienstes wieder. Was in der theologischen Forschung der dreißiger Jahre neu entdeckt wurde - Frieder Schulz hat dazu in dem Jahrbuch "Kerygma und Dogma" 1966 einen sehr lesenswerten Artikel geschrieben -, hat nun auch die ökumenischen Konsensbemühungen zur Eucharistie bestimmt. Die erste Fassung der Erklärung von "Faith and Order" zur Eucharistie (Accra 1974) hat deshalb den drei grundlegenden Aspekten der Eucharistie (Danksagung an den Vater, Anamnese Christi, Anrufung und Gabe des Heiligen Geistes) einen vierten hinzugefügt: Gemeinschaft im Leibe Christi. Die soeben den Kirchen zu erneuter Beratung zugehende zweite Fassung (1981) formuliert noch exakter: "Die eucharistische Gemeinschaft mit dem gegenwärtigen Christus, der das Leben der Kirche stärkt, ist zugleich auch die Gemeinschaft im Leibe Christi, der Kirche. Das Teilen des einen Brotes und des gemeinsamen Kelches an einem bestimmten Ort zeigt und bewirkt, daß die Teilnehmer mit Christus und mit anderen Mitbeteiligten zu allen Zeiten und an allen Orten in Einheit verbunden sind. In der Eucharistie findet die Gemeinschaft (engl. communion!) des Volkes Gottes ihre volle Offenbarung" (No 19). Von hier aus ergeben sich Konsequenzen für alle Lebensbereiche in Kirche und Welt. Koinonia ist eine der großen theologischen Entdeckungen unserer Zeit. Angesichts des Zustandes der Kirchen und der wachsenden Gefährdungen und Nöte der ganzen Welt, wird Koinonia zu einer besonderen Herausforderung und zugleich zu einem Angebot, das die Evangelische Michaelsbruderschaft und der Berneuchener Dienst für den Weg nach dem Jubiläum annehmen, sorgsam zu bedenken und mutig zu verwirklichen suchen sollten. Ob wir aber die inzwischen bewährte Trias Martyria - Leiturgia - Diakonia durch Koinonia erweitern sollten, muß noch weiter durchdacht werden. Koinonia hat ihren Sitz in der eucharistischen Theologie und gehört mit Danksagung, Anamnese, Epiklese und der eschatologischen Perspektive (in der Neufassung des Eucharistietextes findet sich ein fünfter Abschnitt: "Die Eucharistie als Mahl des Reiches") zusammen. Martyria, Leiturgia und Diakonia antworten auf unsere Frage nach dem Dienst der Kirche, ihre Zusammenstellung ist ebenso schlüssig. Man sollte diese Zuordnungen vielleicht belassen. Es wäre reizvoll, die eingangs angedeutete Erweiterung unserer triadischen Formel durch den Begriff Koinonia zu versuchen. Wir kennen ihn aus dem Apostolikum, dort aber in der mißverständlichen Übersetzung Gemeinschaft (der Heiligen), als ob die eben erst gemachte Aussage über die Kirche noch einmal wiederholt werden müsse. Koinonia heißt Teilhabe am Heiligen, nämlich durch den Geist am Leib des erhöhten Herrn, in den sein Leib, die Kirche, nun eingegliedert ist. Koinonia markiert also die Beziehung des erhöhten Herrn zu seiner Gemeinde, die sich in der eucharistischen Mahlzeit vollzieht und deshalb notwendigerweise die Teilhabe der Gemeinde einschließt. Genau in diesem Sinne als Teilhabe an Christus und Teilhabe untereinander versteht Luther Koinonia, die deshalb nicht als Körperschaft oder Genossenschaft (societas) gedeutet und als Parallele zu Ekklesia/ Kirche gebraucht werden darf. Mit der Wiedergewinnung des Koinonia-Aspektes findet die gottesdienstliche Gemeinde aus der Einengung des Blickes auf individuelle Sündenvergebung, auf die Gültigkeit, auf die Sicherung der Realpräsenz und auf die Elemente heraus, die in beiden Kirchen die Gabe Christi verdunkelt, sie findet ihren Wesenszug ab empfangende und gebende Gemeinschaft und damit auch die eminent soziale Komponente des Gottesdienstes wieder. Was in der theologischen Forschung der dreißiger Jahre neu entdeckt wurde - Frieder Schulz hat dazu in dem Jahrbuch "Kerygma und Dogma" 1966 einen sehr lesenswerten Artikel geschrieben -, hat nun auch die ökumenischen Konsensbemühungen zur Eucharistie bestimmt. Die erste Fassung der Erklärung von "Faith and Order" zur Eucharistie (Accra 1974) hat deshalb den drei grundlegenden Aspekten der Eucharistie (Danksagung an den Vater, Anamnese Christi, Anrufung und Gabe des Heiligen Geistes) einen vierten hinzugefügt: Gemeinschaft im Leibe Christi. Die soeben den Kirchen zu erneuter Beratung zugehende zweite Fassung (1981) formuliert noch exakter: "Die eucharistische Gemeinschaft mit dem gegenwärtigen Christus, der das Leben der Kirche stärkt, ist zugleich auch die Gemeinschaft im Leibe Christi, der Kirche. Das Teilen des einen Brotes und des gemeinsamen Kelches an einem bestimmten Ort zeigt und bewirkt, daß die Teilnehmer mit Christus und mit anderen Mitbeteiligten zu allen Zeiten und an allen Orten in Einheit verbunden sind. In der Eucharistie findet die Gemeinschaft (engl. communion!) des Volkes Gottes ihre volle Offenbarung" (No 19). Von hier aus ergeben sich Konsequenzen für alle Lebensbereiche in Kirche und Welt. Koinonia ist eine der großen theologischen Entdeckungen unserer Zeit. Angesichts des Zustandes der Kirchen und der wachsenden Gefährdungen und Nöte der ganzen Welt, wird Koinonia zu einer besonderen Herausforderung und zugleich zu einem Angebot, das die Evangelische Michaelsbruderschaft und der Berneuchener Dienst für den Weg nach dem Jubiläum annehmen, sorgsam zu bedenken und mutig zu verwirklichen suchen sollten. Ob wir aber die inzwischen bewährte Trias Martyria - Leiturgia - Diakonia durch Koinonia erweitern sollten, muß noch weiter durchdacht werden. Koinonia hat ihren Sitz in der eucharistischen Theologie und gehört mit Danksagung, Anamnese, Epiklese und der eschatologischen Perspektive (in der Neufassung des Eucharistietextes findet sich ein fünfter Abschnitt: "Die Eucharistie als Mahl des Reiches") zusammen. Martyria, Leiturgia und Diakonia antworten auf unsere Frage nach dem Dienst der Kirche, ihre Zusammenstellung ist ebenso schlüssig. Man sollte diese Zuordnungen vielleicht belassen.
© Dr. Hans-Christoph Schmidt-Lauber
Quatember 1981, S. 160-172
|