 Zu den Betrachtungen über das Vaterunser schreibt eine Leserin: „Es wäre doch vielleicht noch einer besonderen Not Erwähnung zu tun; ich meine jenen Zustand, der oft wie eine Krankheit über die Seele hereinbricht und bei dem es auch bei äußerer Stille und Ruhe nicht zu der wirklichen Stille, dem Schweigen des Herzens kommen kann, sondern wo es im Inneren erst recht anfängt zu reden in zwangsweisen Grübeleien und selbstquälerischen Reflexionen, gegen die alle eigene Willenskraft machtlos ist. Auch die Zuflucht in das feststehende gegebene Gebet kann nicht die entscheidende Hilfe geben, weil die innere Unruhe auch hierbei nicht weicht, sondern im Gegenteil dazu führt, daß das Beten ein Plappern wird, mechanisch, gedankenlos. Das eigene Wissen um dieses alles führt zwangsläufig in einen Zustand der Verzweiflung hinein, in dem schließlich unter einem tiefen Abscheu vor dem eigenen Zustand jeder weitere Versuch zu beten unterbleibt... Das gesamte Dasein bis in die Arbeit im Beruf und in das Zusammenleben mit den Nächsten hinein ist von innen her zerstörenden Mächten preisgegeben; kurz: es hebt eine Qual an, die sich dem mitteilenden Wort völlig entzieht. Gibt es hierfür eine Hilfe?” Zu den Betrachtungen über das Vaterunser schreibt eine Leserin: „Es wäre doch vielleicht noch einer besonderen Not Erwähnung zu tun; ich meine jenen Zustand, der oft wie eine Krankheit über die Seele hereinbricht und bei dem es auch bei äußerer Stille und Ruhe nicht zu der wirklichen Stille, dem Schweigen des Herzens kommen kann, sondern wo es im Inneren erst recht anfängt zu reden in zwangsweisen Grübeleien und selbstquälerischen Reflexionen, gegen die alle eigene Willenskraft machtlos ist. Auch die Zuflucht in das feststehende gegebene Gebet kann nicht die entscheidende Hilfe geben, weil die innere Unruhe auch hierbei nicht weicht, sondern im Gegenteil dazu führt, daß das Beten ein Plappern wird, mechanisch, gedankenlos. Das eigene Wissen um dieses alles führt zwangsläufig in einen Zustand der Verzweiflung hinein, in dem schließlich unter einem tiefen Abscheu vor dem eigenen Zustand jeder weitere Versuch zu beten unterbleibt... Das gesamte Dasein bis in die Arbeit im Beruf und in das Zusammenleben mit den Nächsten hinein ist von innen her zerstörenden Mächten preisgegeben; kurz: es hebt eine Qual an, die sich dem mitteilenden Wort völlig entzieht. Gibt es hierfür eine Hilfe?”
 Die Zustände der Seele, auf die Sie unsere Aufmerksamkeit lenken, sind allen denen bekannt, die von den wirklichen Erfahrungen des Gebetslebens zu berichten wissen und darum nicht mehr in einer schwärmerisch unwirklichen Weise vom Gebet als einem Allheilmittel reden können, und sie sind in den Büchern dieser begnadeten und angefochtenen Beter zum Teil mit sehr ähnlichen Worten, wie Sie sie gebrauchen, beschrieben. Nicht der Mensch, der überhaupt nicht betet und das Gebet nicht vermißt, weil er seine Gnadenkräfte nicht kennt, sondern gerade der Beter ist solchen Anfechtungen ausgesetzt und preisgegeben. „Der Teufel frißt mir all mein Beten weg”, so hieß es einmal in einem solchen Bericht. Die Zustände der Seele, auf die Sie unsere Aufmerksamkeit lenken, sind allen denen bekannt, die von den wirklichen Erfahrungen des Gebetslebens zu berichten wissen und darum nicht mehr in einer schwärmerisch unwirklichen Weise vom Gebet als einem Allheilmittel reden können, und sie sind in den Büchern dieser begnadeten und angefochtenen Beter zum Teil mit sehr ähnlichen Worten, wie Sie sie gebrauchen, beschrieben. Nicht der Mensch, der überhaupt nicht betet und das Gebet nicht vermißt, weil er seine Gnadenkräfte nicht kennt, sondern gerade der Beter ist solchen Anfechtungen ausgesetzt und preisgegeben. „Der Teufel frißt mir all mein Beten weg”, so hieß es einmal in einem solchen Bericht.
 Sie haben natürlich vollkommen recht, wenn Sie sagen, daß die Willenskraft gegenüber solchen inneren Zuständen ohnmächtig ist; denn hier sind gerade jene tieferen Schichten des inneren Gefüges unzugänglich geworden, in denen der Trost der gnädigen Nähe Gottes empfangen oder entbehrt wird. In manchen Fällen ist hier, vielleicht durch schwere eigene Erlebnisse seelischer oder auch körperlicher Art, soviel gestört, daß nur eine sorgfältige und tiefdringende seelische Beratung diesen Bann lösen und den Atem der Seele wieder frei ausströmen lassen könnte; ein erfahrener Seelsorger wird im persönlichen Gespräch (freilich nicht ohne ein solches) erkennen, ob eine solche tiefenpsychologische Behandlung (die ja immer einer Operation gleichzuachten ist) ratsam ist und die Aussicht auf völlige Heilung dieser Schäden gewährt. Jedem, dem Gesunden wie dem „Kranken” (da die Unterschiede zwischen „gesund” und „krank” durchaus fließend sind), wäre aber zunächst anzuraten, daß er sich nicht so sehr für seine seelischen Zustände interessieren und damit beschäftigen soll. So gewiß der Blick ins Dunkel die Angstzustände steigern kann, die die Finsternis erweckt, so gehört die innere Nötigung, selber immer auf diese innere Unruhe der Seele zu achten, zur „Naturgeschichte” solcher Anfechtungen. Sie haben natürlich vollkommen recht, wenn Sie sagen, daß die Willenskraft gegenüber solchen inneren Zuständen ohnmächtig ist; denn hier sind gerade jene tieferen Schichten des inneren Gefüges unzugänglich geworden, in denen der Trost der gnädigen Nähe Gottes empfangen oder entbehrt wird. In manchen Fällen ist hier, vielleicht durch schwere eigene Erlebnisse seelischer oder auch körperlicher Art, soviel gestört, daß nur eine sorgfältige und tiefdringende seelische Beratung diesen Bann lösen und den Atem der Seele wieder frei ausströmen lassen könnte; ein erfahrener Seelsorger wird im persönlichen Gespräch (freilich nicht ohne ein solches) erkennen, ob eine solche tiefenpsychologische Behandlung (die ja immer einer Operation gleichzuachten ist) ratsam ist und die Aussicht auf völlige Heilung dieser Schäden gewährt. Jedem, dem Gesunden wie dem „Kranken” (da die Unterschiede zwischen „gesund” und „krank” durchaus fließend sind), wäre aber zunächst anzuraten, daß er sich nicht so sehr für seine seelischen Zustände interessieren und damit beschäftigen soll. So gewiß der Blick ins Dunkel die Angstzustände steigern kann, die die Finsternis erweckt, so gehört die innere Nötigung, selber immer auf diese innere Unruhe der Seele zu achten, zur „Naturgeschichte” solcher Anfechtungen.
 So wenig wir das beliebte „So nimm denn meine Hände” zu den großen und klassischen Liedern unserer Kirche rechnen werden, so drückt doch die Zeile „wenn ich auch gleich nichts fühle von Deiner Macht” eine sehr heilsame und sehr tröstliche Erfahrung aus, daß es nämlich gar nicht so sehr wichtig ist, in welchen Zuständen der Gottesnähe oder Gottesferne sich unsere Seele augenblicklich befindet, und es wird sozusagen der Trick, durch den der böse Feind uns in seinem Bann hält, durchschaut und vereitelt, wenn wir den Mut fassen könnten, dieses Dunkel der Seele als eine Anfechtung zu erkennen und darauf zu vertrauen, daß der Heilige Geist Gottes uns mit unaussprechlichem Seufzen vertritt (Röm. 8), wenn das Vermögen zu beten in uns gelähmt ist. Es ist ein ähnlicher Vorgang, wie wenn ein Kind, das sich allein im lichtlosen Zimmer fürchtet, sich mit den Händen vom einen zum anderen tastet: „Sie sind ja alle noch da, die Dinge, die ich nicht sehe!” Ich glaube darum auch nicht, daß man die Treue im täglichen Gebet, das zugleich von selbstquälerischen Gedanken ganz anderer Art begleitet ist, als ein mechanisches Plappern entwerten und sich selber verleiden darf. Es geschieht in solchem Gebet immer mehr als das, was unser Bewußtsein erreicht. Ein paar einfache Gebetsworte, wie das „Ehre fei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste” oder eine Liedzeile, regelmäßig wiederholt, können bis in die tiefsten Gründe der Seele dringen, wie ein tief eingegrabenes Samenkorn; oder, um es in einem anderen Bild zu sagen: solche Worte können wie eine Engelwache sein, die „im innersten Gemüte Ordnung hält”, während die Oberflächenschicht unserer Seele vom Teufel geplagt und mit großer Traurigkeit erfüllt wird. Sie verstehen, daß ich Ihnen Mut machen möchte, mit Ihrem Gebet in der Ihnen gewohnten Form fortzufahren, auch dann, wenn Sie von der Sorge angefochten werden, daß sich solche „leere” Gewohnheit schädlich erweisen könnte. So wenig wir das beliebte „So nimm denn meine Hände” zu den großen und klassischen Liedern unserer Kirche rechnen werden, so drückt doch die Zeile „wenn ich auch gleich nichts fühle von Deiner Macht” eine sehr heilsame und sehr tröstliche Erfahrung aus, daß es nämlich gar nicht so sehr wichtig ist, in welchen Zuständen der Gottesnähe oder Gottesferne sich unsere Seele augenblicklich befindet, und es wird sozusagen der Trick, durch den der böse Feind uns in seinem Bann hält, durchschaut und vereitelt, wenn wir den Mut fassen könnten, dieses Dunkel der Seele als eine Anfechtung zu erkennen und darauf zu vertrauen, daß der Heilige Geist Gottes uns mit unaussprechlichem Seufzen vertritt (Röm. 8), wenn das Vermögen zu beten in uns gelähmt ist. Es ist ein ähnlicher Vorgang, wie wenn ein Kind, das sich allein im lichtlosen Zimmer fürchtet, sich mit den Händen vom einen zum anderen tastet: „Sie sind ja alle noch da, die Dinge, die ich nicht sehe!” Ich glaube darum auch nicht, daß man die Treue im täglichen Gebet, das zugleich von selbstquälerischen Gedanken ganz anderer Art begleitet ist, als ein mechanisches Plappern entwerten und sich selber verleiden darf. Es geschieht in solchem Gebet immer mehr als das, was unser Bewußtsein erreicht. Ein paar einfache Gebetsworte, wie das „Ehre fei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste” oder eine Liedzeile, regelmäßig wiederholt, können bis in die tiefsten Gründe der Seele dringen, wie ein tief eingegrabenes Samenkorn; oder, um es in einem anderen Bild zu sagen: solche Worte können wie eine Engelwache sein, die „im innersten Gemüte Ordnung hält”, während die Oberflächenschicht unserer Seele vom Teufel geplagt und mit großer Traurigkeit erfüllt wird. Sie verstehen, daß ich Ihnen Mut machen möchte, mit Ihrem Gebet in der Ihnen gewohnten Form fortzufahren, auch dann, wenn Sie von der Sorge angefochten werden, daß sich solche „leere” Gewohnheit schädlich erweisen könnte.
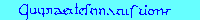
 Die Fußnote aus Seite 7 des Weihnachtsbriefes, worin ich begründet hatte, warum die Anrede „Vater unser” der Form „Unser Vater” vorzuziehen sei, hat mir einen temperamentvollen Protest eines treuen Gliedes unseres Kreises eingetragen. Ich weiß natürlich, daß es andere evangelische - und zwar nicht nur „reformierte”! - Kirchen gibt, in denen die Anrede „Unser Vater” gebräuchlich ist. Die Frage ist also gewiß nicht zu den „Unterscheidungslehren” zwischen lutherischer und reformierter Überlieferung zu zählen. Ebenso wenig läßt sich meine Bemerkung durch den Hinweis entkräften, daß ja Luther selbst in seiner Bibelübersetzung (Matth. 6; Luk. 11) die andere Fassung hat: „Unser Vater”; denn Luther selbst hat ja in den Katechismustext dieses Gebetes nicht die Fassung aus seiner Bibelübersetzung übernommen, sondern den schon damals gebräuchlichen „liturgischen” Text „Vater unser” beibehalten. Und das doch wohl nicht ohne tieferen Grund. Ob sich Luther bewußt war, daß erst die lateinische Übersetzung den Genetiv des griechischen Textes (hemon) in das Possessiv-Pronomen (noster) verwandelt hat, wird sich schwer feststellen lassen; sicher aber war es ihm wichtig, nicht das Wort „unser”, sondern die betonte und entscheidende wichtige Anrede „Vater” an die Spitze zu rücken, und da die deutsche Sprache leider die Stellung des Adjektivs hinter dem Substantiv („Vater allmächtig”, wie es im 1. Glaubensartikel heißen müßte, um die falsche Verbindung des Wortes „allmächtig” mit „Schöpfer” zu vermeiden), im allgemeinen nicht kennt, bot sich die Genitivform von „uns”, um die dem griechischen Text und dem Gewicht der Worte entsprechende Stellung zu erreichen oder vielmehr zu bewahren: „Vater unser”. Die Fußnote aus Seite 7 des Weihnachtsbriefes, worin ich begründet hatte, warum die Anrede „Vater unser” der Form „Unser Vater” vorzuziehen sei, hat mir einen temperamentvollen Protest eines treuen Gliedes unseres Kreises eingetragen. Ich weiß natürlich, daß es andere evangelische - und zwar nicht nur „reformierte”! - Kirchen gibt, in denen die Anrede „Unser Vater” gebräuchlich ist. Die Frage ist also gewiß nicht zu den „Unterscheidungslehren” zwischen lutherischer und reformierter Überlieferung zu zählen. Ebenso wenig läßt sich meine Bemerkung durch den Hinweis entkräften, daß ja Luther selbst in seiner Bibelübersetzung (Matth. 6; Luk. 11) die andere Fassung hat: „Unser Vater”; denn Luther selbst hat ja in den Katechismustext dieses Gebetes nicht die Fassung aus seiner Bibelübersetzung übernommen, sondern den schon damals gebräuchlichen „liturgischen” Text „Vater unser” beibehalten. Und das doch wohl nicht ohne tieferen Grund. Ob sich Luther bewußt war, daß erst die lateinische Übersetzung den Genetiv des griechischen Textes (hemon) in das Possessiv-Pronomen (noster) verwandelt hat, wird sich schwer feststellen lassen; sicher aber war es ihm wichtig, nicht das Wort „unser”, sondern die betonte und entscheidende wichtige Anrede „Vater” an die Spitze zu rücken, und da die deutsche Sprache leider die Stellung des Adjektivs hinter dem Substantiv („Vater allmächtig”, wie es im 1. Glaubensartikel heißen müßte, um die falsche Verbindung des Wortes „allmächtig” mit „Schöpfer” zu vermeiden), im allgemeinen nicht kennt, bot sich die Genitivform von „uns”, um die dem griechischen Text und dem Gewicht der Worte entsprechende Stellung zu erreichen oder vielmehr zu bewahren: „Vater unser”.
 Es besteht kein Anlaß, sich über diese meine Bemerkung konfessionell zu erregen („Wenn schon eine evangelische Kirche, die auch ihre reichlichen Märtyrer hat, „Unser Vater” sagt, dann darf ein lutherischer Bischof dieses „Unser Vater” nicht so schlecht machen...”); zumal ohne weiteres zuzugeben ist, daß bei der 7. Bitte die „reformierte” Fassung „Erlöse uns von dem Bösen” sehr wahrscheinlich dem Sinn des Urtextes besser gerecht wird als Luthers Übersetzung „Erlöse uns von dem Übel”. Aber wohin kommen wir, wenn man nicht mehr unbefangen sagen darf, was richtig (und was zwar nicht falsch, aber weniger richtig) ist, ohne konfessionelle Empfindlichkeiten zu verletzen? Es besteht kein Anlaß, sich über diese meine Bemerkung konfessionell zu erregen („Wenn schon eine evangelische Kirche, die auch ihre reichlichen Märtyrer hat, „Unser Vater” sagt, dann darf ein lutherischer Bischof dieses „Unser Vater” nicht so schlecht machen...”); zumal ohne weiteres zuzugeben ist, daß bei der 7. Bitte die „reformierte” Fassung „Erlöse uns von dem Bösen” sehr wahrscheinlich dem Sinn des Urtextes besser gerecht wird als Luthers Übersetzung „Erlöse uns von dem Übel”. Aber wohin kommen wir, wenn man nicht mehr unbefangen sagen darf, was richtig (und was zwar nicht falsch, aber weniger richtig) ist, ohne konfessionelle Empfindlichkeiten zu verletzen?
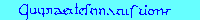
 In den sechs Sätzen einer geistlichen Lebensordnung, die ich in meiner „Regel des geistlichen Lebens” ausgelegt habe, drückt der 6. Satz die Bereitschaft aus, „seelsorgerlichen Rat anzunehmen”, und das Wissen darum, daß „die Glieder am Leibe Christi brüderliche Zucht an sich üben lassen und aneinander üben”. Wir erfahren immer wieder, daß dieser Satz für manche, die sich an sich nach einer solchen festen Ordnung sehnen, eine besondere Schwierigkeit bedeutet; und zwar beklagen sich die einen, daß es in unserer Kirche so wenige Seelsorger gebe, die zu solchem Dienst bereit und geschickt sind, während die anderen einen Zwang fürchten und eine Verpflichtung zur Einzelbeichte. Das eine ist eine wirkliche Not, die sicher damit zusammenhängt, daß nicht jeder Pfarrer selbst in einer festen und regelmäßigen seelsorgerlichen Bindung steht; aber es ist ja auch keineswegs festgelegt, daß es ein Pfarrer sein muß, von dem der einzelne Christ diesen seelsorgerlichen Rat erbittet und empfängt; wenn es einen wirklich begründeten Unterschied zwischen Seelsorge und allgemeiner Beratung in schwierigen Lebensfragen gibt, so liegt dieser Unterschied gewiß nicht an Beruf und Stand dessen, der Seelsorge übt. Was das andere anlangt, so würde jeder Zwang zur Einzelbeichte einem evangelischen Verständnis der Beichte widerstreiten. Wenn mir also jemand schreibt: „Ich habe kein Verlangen nach Privatbeichte und sehe ihre Notwendigkeit nicht ein”, so werden wir das gewiß nicht als einen Mangel an geistlicher Reife und Erkenntnis ansehen, aber wir sind dankbar, daß wir denen, die Verlangen danach tragen, den Dienst der Einzelbeichte anbieten können. Auf die Frage, die immer wieder an uns gestellt wird: „Ist es denn notwendig, daß ich meine Schuld ausspreche vor einem Menschen?”, ist also klar zu antworten: Nein, es ist nicht notwendig; aber es gibt Dinge, die zwar nicht notwendig, aber nützlich, hilfreich und heilsam sind. In den sechs Sätzen einer geistlichen Lebensordnung, die ich in meiner „Regel des geistlichen Lebens” ausgelegt habe, drückt der 6. Satz die Bereitschaft aus, „seelsorgerlichen Rat anzunehmen”, und das Wissen darum, daß „die Glieder am Leibe Christi brüderliche Zucht an sich üben lassen und aneinander üben”. Wir erfahren immer wieder, daß dieser Satz für manche, die sich an sich nach einer solchen festen Ordnung sehnen, eine besondere Schwierigkeit bedeutet; und zwar beklagen sich die einen, daß es in unserer Kirche so wenige Seelsorger gebe, die zu solchem Dienst bereit und geschickt sind, während die anderen einen Zwang fürchten und eine Verpflichtung zur Einzelbeichte. Das eine ist eine wirkliche Not, die sicher damit zusammenhängt, daß nicht jeder Pfarrer selbst in einer festen und regelmäßigen seelsorgerlichen Bindung steht; aber es ist ja auch keineswegs festgelegt, daß es ein Pfarrer sein muß, von dem der einzelne Christ diesen seelsorgerlichen Rat erbittet und empfängt; wenn es einen wirklich begründeten Unterschied zwischen Seelsorge und allgemeiner Beratung in schwierigen Lebensfragen gibt, so liegt dieser Unterschied gewiß nicht an Beruf und Stand dessen, der Seelsorge übt. Was das andere anlangt, so würde jeder Zwang zur Einzelbeichte einem evangelischen Verständnis der Beichte widerstreiten. Wenn mir also jemand schreibt: „Ich habe kein Verlangen nach Privatbeichte und sehe ihre Notwendigkeit nicht ein”, so werden wir das gewiß nicht als einen Mangel an geistlicher Reife und Erkenntnis ansehen, aber wir sind dankbar, daß wir denen, die Verlangen danach tragen, den Dienst der Einzelbeichte anbieten können. Auf die Frage, die immer wieder an uns gestellt wird: „Ist es denn notwendig, daß ich meine Schuld ausspreche vor einem Menschen?”, ist also klar zu antworten: Nein, es ist nicht notwendig; aber es gibt Dinge, die zwar nicht notwendig, aber nützlich, hilfreich und heilsam sind.
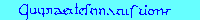
 Was ich im „Fastenbrief” über Konversion geschrieben habe, hat die Frage ausgelöst, ob nicht dieses Urteil über den Konfessionswechsel als Anachronismus bestimmte Konsequenzen für die Beurteilung der Mischehen hat. Das ist in der Tat in gewissem Maße der Fall. An keinem Punkt wird das verschiedene Selbstverständnis der beiden großen Zweige der christlichen Kirche so peinlich und schmerzlich spürbar, wie in der Frage der Mischehen. Die römisch-katholische Kirche erkennt grundsätzlich keine nicht von einem ihrer Priester eingesegnete Ehe als gültige Ehe, als Verwirklichung jenes Mysteriums an; von dem der Apostel im 5. Kapitel des Epheserbriefes redet. Das ist freilich nicht eigentlich in dem katholischen Verständnis des Sakramentes, also dogmalisch, sondern vielmehr in den Vorschriften des römischen Kirchenrechts, also juristisch, begründet. Aber man sollte nicht als besondere Unduldsamkeit schmähen, was so tief und mit einer so zwingenden Logik in dem Rechtsdenken der römischen Kirche begründet ist. Wir alle wissen, welches Ausmaß von ehelichen Schwierigkeiten und von seelischen Nöten aus dieser Haltung der römisch-katholischen Kirche erwächst. Die weit verbreitete Meinung, die evangelische Kirche nähme die Zugehörigkeit zu ihr nicht ebenso ernst und es könne also dem evangelischen Christen von Seiten seiner Kirche „nichts passieren”, der in eine katholische Trauung und katholische Erziehung seiner Kinder einwilligt, zwingt uns zu Bestimmungen, die die Tragweite einer solchen Entscheidung deutlich ins Bewußtsein heben. Was ich im „Fastenbrief” über Konversion geschrieben habe, hat die Frage ausgelöst, ob nicht dieses Urteil über den Konfessionswechsel als Anachronismus bestimmte Konsequenzen für die Beurteilung der Mischehen hat. Das ist in der Tat in gewissem Maße der Fall. An keinem Punkt wird das verschiedene Selbstverständnis der beiden großen Zweige der christlichen Kirche so peinlich und schmerzlich spürbar, wie in der Frage der Mischehen. Die römisch-katholische Kirche erkennt grundsätzlich keine nicht von einem ihrer Priester eingesegnete Ehe als gültige Ehe, als Verwirklichung jenes Mysteriums an; von dem der Apostel im 5. Kapitel des Epheserbriefes redet. Das ist freilich nicht eigentlich in dem katholischen Verständnis des Sakramentes, also dogmalisch, sondern vielmehr in den Vorschriften des römischen Kirchenrechts, also juristisch, begründet. Aber man sollte nicht als besondere Unduldsamkeit schmähen, was so tief und mit einer so zwingenden Logik in dem Rechtsdenken der römischen Kirche begründet ist. Wir alle wissen, welches Ausmaß von ehelichen Schwierigkeiten und von seelischen Nöten aus dieser Haltung der römisch-katholischen Kirche erwächst. Die weit verbreitete Meinung, die evangelische Kirche nähme die Zugehörigkeit zu ihr nicht ebenso ernst und es könne also dem evangelischen Christen von Seiten seiner Kirche „nichts passieren”, der in eine katholische Trauung und katholische Erziehung seiner Kinder einwilligt, zwingt uns zu Bestimmungen, die die Tragweite einer solchen Entscheidung deutlich ins Bewußtsein heben.
 Aber es wäre zweifellos verkehrt, allein das römische Kirchenrecht für all die Schwierigkeiten verantwortlich zu machen, die fast mit innerer Notwendigkeit in einer Ehe erwachsen, die zwischen Angehörigen verschiedener Konfessionen geschlossen wird. Nur wenn beide Ehegatten ihrer Kirche mit einer gewissen lauen Gleichgültigkeit gegenüberstehen, wird die Verschiedenheit der Konfession ebenso wenig als störend, wie die Zugehörigkeit zur eigenen Kirche als verpflichtend empfunden. Wenn ein Teil wirklichen und tätigen Anteil am Leben seiner Kirche nimmt, der andere Teil aber der eigenen wie der fremden Kirche innerlich unbeteiligt gegenübersteht, so bedeutet das immer und mit unausweichlicher Notwendigkeit einen Mangel an Tiefe und letzter Erfüllung in der Gemeinschaft der Ehegatten. Auch wenn beide einander wirklich lieben und darum den ehrlichen Willen haben, auch diese Schwierigkeit in gegenseitiger Liebe zu tragen und zu überwinden, wird alsbald dieser Mangel schmerzlich fühlbar, wenn die Verschiedenheit der kirchlichen Gewöhnung nicht nur eine gemeinsame Feier des Sakramentes, sondern auch einen gemeinsamen Kirchgang, ja selbst ein gemeinsames Gebet unmöglich macht oder in Frage stellt, und erst recht wird die Erziehung der Kinder den einen Elternteil praktisch ausschließen von der wirklichen Mitverantwortung und von der unmittelbaren und tätigen Anteilnahme an einer christlichen Erziehung. Nur in seltenen Ausnahmefällen können Ehegatten, die auf beiden Seiten lautere Frömmigkeit und kirchliche Treue mit einer großen Weitschaft verbinden, diese nie aufzuhebende Spannung zu einer Quelle immer neuer Liebe und tiefer Gemeinsamkeit machen. Aber es wäre zweifellos verkehrt, allein das römische Kirchenrecht für all die Schwierigkeiten verantwortlich zu machen, die fast mit innerer Notwendigkeit in einer Ehe erwachsen, die zwischen Angehörigen verschiedener Konfessionen geschlossen wird. Nur wenn beide Ehegatten ihrer Kirche mit einer gewissen lauen Gleichgültigkeit gegenüberstehen, wird die Verschiedenheit der Konfession ebenso wenig als störend, wie die Zugehörigkeit zur eigenen Kirche als verpflichtend empfunden. Wenn ein Teil wirklichen und tätigen Anteil am Leben seiner Kirche nimmt, der andere Teil aber der eigenen wie der fremden Kirche innerlich unbeteiligt gegenübersteht, so bedeutet das immer und mit unausweichlicher Notwendigkeit einen Mangel an Tiefe und letzter Erfüllung in der Gemeinschaft der Ehegatten. Auch wenn beide einander wirklich lieben und darum den ehrlichen Willen haben, auch diese Schwierigkeit in gegenseitiger Liebe zu tragen und zu überwinden, wird alsbald dieser Mangel schmerzlich fühlbar, wenn die Verschiedenheit der kirchlichen Gewöhnung nicht nur eine gemeinsame Feier des Sakramentes, sondern auch einen gemeinsamen Kirchgang, ja selbst ein gemeinsames Gebet unmöglich macht oder in Frage stellt, und erst recht wird die Erziehung der Kinder den einen Elternteil praktisch ausschließen von der wirklichen Mitverantwortung und von der unmittelbaren und tätigen Anteilnahme an einer christlichen Erziehung. Nur in seltenen Ausnahmefällen können Ehegatten, die auf beiden Seiten lautere Frömmigkeit und kirchliche Treue mit einer großen Weitschaft verbinden, diese nie aufzuhebende Spannung zu einer Quelle immer neuer Liebe und tiefer Gemeinsamkeit machen.
 Aufs Ganze gesehen muß ich nach den Erfahrungen vieler Jahre es für richtig halten, wenn, ehe die Ehe geschlossen wird, der eine der beiden Teile zur Konfession des andern übertritt, wobei naturgemäß derjenige, der am tiefsten und festesten in feiner Kirche wurzelt und lebt, den andern nach sich ziehen wird. Daß so viele Mischehen geschlossen werden, ist selbst ein Zeichen dafür, wie wenig für weitaus die meisten die kirchliche Zugehörigkeit existentiell bedeutet; der leichtfertige Optimismus, der das gar nicht für eine ernste Schwierigkeit hält, wird zumeist durch spätere Erfahrungen widerlegt, und es ist nichts dagegen und vieles dafür zu sagen, wenn derjenige der Eheschließenden, der in seiner Kirche wirklich lebt, den Übertritt des andern zur Bedingung der Eheschließung macht. Jedenfalls ist dieses die klarste und sauberste Lösung, die mit der relativ meisten Sicherheit spätere Schwierigkeiten vermeidet. Es bedarf hoffentlich keiner Begründung, warum dieser seelsorgerliche Rat nicht in Widerspruch steht zu dem, was im vorigen Brief über Konversionen gesagt wurde; denn hier, bei Mischehen, handelt es sich zumeist überhaupt nicht um einen Wechsel religiöser Überzeugung, sondern darum, daß ein mehr oder weniger religiös gleichgültiger Mensch in der Kirche seines Ehegatten überhaupt eine kirchliche Heimat, zugleich die kirchliche Bindung seiner Ehe sucht. Aufs Ganze gesehen muß ich nach den Erfahrungen vieler Jahre es für richtig halten, wenn, ehe die Ehe geschlossen wird, der eine der beiden Teile zur Konfession des andern übertritt, wobei naturgemäß derjenige, der am tiefsten und festesten in feiner Kirche wurzelt und lebt, den andern nach sich ziehen wird. Daß so viele Mischehen geschlossen werden, ist selbst ein Zeichen dafür, wie wenig für weitaus die meisten die kirchliche Zugehörigkeit existentiell bedeutet; der leichtfertige Optimismus, der das gar nicht für eine ernste Schwierigkeit hält, wird zumeist durch spätere Erfahrungen widerlegt, und es ist nichts dagegen und vieles dafür zu sagen, wenn derjenige der Eheschließenden, der in seiner Kirche wirklich lebt, den Übertritt des andern zur Bedingung der Eheschließung macht. Jedenfalls ist dieses die klarste und sauberste Lösung, die mit der relativ meisten Sicherheit spätere Schwierigkeiten vermeidet. Es bedarf hoffentlich keiner Begründung, warum dieser seelsorgerliche Rat nicht in Widerspruch steht zu dem, was im vorigen Brief über Konversionen gesagt wurde; denn hier, bei Mischehen, handelt es sich zumeist überhaupt nicht um einen Wechsel religiöser Überzeugung, sondern darum, daß ein mehr oder weniger religiös gleichgültiger Mensch in der Kirche seines Ehegatten überhaupt eine kirchliche Heimat, zugleich die kirchliche Bindung seiner Ehe sucht.
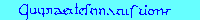
 Kürzlich hörte ich einen Vortrag, durch den ich mit dem Wort „Sozialtechnik” Bekanntschaft machte. Das Wort war mir bis dahin nicht begegnet, und ich wußte nicht, daß mir damit ein wesentlicher Beitrag zum Verständnis und zur Bewältigung unserer Zeit mangelte. Da der Vortragende keine Gebrauchsanweisung für diese von ihm bevorzugte Vokabel gab, war ich aus meinen eigenen Spürsinn angewiesen, der sich zäh und hartnäckig an den Geruch der beiden Partner dieser Fremdwort-Paarung heftete. Ich muß mir gewiß den Vorwurf gefallen lassen, sehr altmodisch zu sein, wenn ich bekenne, daß mich schon das Wort „sozial” in allen seinen Anwendungen und Zusammensetzungen mit einem schwer überwindlichen Mißtrauen erfüllt. Ich glaube zu wissen, daß es sich dabei immer um Fragen des menschlichen Mit-einander handelt, und ich bin tief davon durchdrungen, daß sich ebenso das Schicksal der Welt wie das Schicksal eines jeden Menschen daran entscheidet, wie er seinen Mitmenschen begegnet und seine Beziehungen zu diesen seinen Mitmenschen ordnet (oder nicht ordnet); aber ich werde den Verdacht nicht los, daß der beliebte Gebrauch des Fremdwortes „sozial” die buntgemalte Kulisse allgemeiner, öffentlicher und politischer Fragen vor die vordergründige Wirklichkeit unserer unmittelbaren menschlichen Beziehungen - die Bibel redet handfest und deutlich von unserem „Nächsten” - schiebt. Kürzlich hörte ich einen Vortrag, durch den ich mit dem Wort „Sozialtechnik” Bekanntschaft machte. Das Wort war mir bis dahin nicht begegnet, und ich wußte nicht, daß mir damit ein wesentlicher Beitrag zum Verständnis und zur Bewältigung unserer Zeit mangelte. Da der Vortragende keine Gebrauchsanweisung für diese von ihm bevorzugte Vokabel gab, war ich aus meinen eigenen Spürsinn angewiesen, der sich zäh und hartnäckig an den Geruch der beiden Partner dieser Fremdwort-Paarung heftete. Ich muß mir gewiß den Vorwurf gefallen lassen, sehr altmodisch zu sein, wenn ich bekenne, daß mich schon das Wort „sozial” in allen seinen Anwendungen und Zusammensetzungen mit einem schwer überwindlichen Mißtrauen erfüllt. Ich glaube zu wissen, daß es sich dabei immer um Fragen des menschlichen Mit-einander handelt, und ich bin tief davon durchdrungen, daß sich ebenso das Schicksal der Welt wie das Schicksal eines jeden Menschen daran entscheidet, wie er seinen Mitmenschen begegnet und seine Beziehungen zu diesen seinen Mitmenschen ordnet (oder nicht ordnet); aber ich werde den Verdacht nicht los, daß der beliebte Gebrauch des Fremdwortes „sozial” die buntgemalte Kulisse allgemeiner, öffentlicher und politischer Fragen vor die vordergründige Wirklichkeit unserer unmittelbaren menschlichen Beziehungen - die Bibel redet handfest und deutlich von unserem „Nächsten” - schiebt.
 Aber nun sollen also die uns bedrängenden „sozialen” Fragen offenbar Gegenstand einer zweckmäßigen Technik werden. Denn, nicht wahr, die Technik muß doch zweckmäßig sein, und wenn sie sich als unzweckmäßig erweist, so ist sie zweifellos eine schlechte Technik. Immer aber schließt der Begriff der Technik eine bewußte Veranstaltung, ein zweckmäßig gewähltes und angewandtes Mittel, ein Werkzeug, eine Methode, eine Erleichterung und Beschleunigung, wie sie eben das zweckmäßig erdachte Hilfsmittel gewahrt, in sich; sonst wäre es ja vielleicht gar ein einfaches menschliches Verhalten, eine „Handlung”, zu der die Hand (vielleicht in Verbindung mit dem Mund, der etwas zu sagen hat) ausreicht. Zu Fuß gehen ist keine Technik, Autofahren ist Technik; einen Gruß mit der Hand auf eine Karte schreiben, ist eine vortechnische Handlung; telefonisch ein Telegramm aufgeben, ist die technisch höher entwickelte Unternehmung. Also bitte „Sozialtechnik”! Da der gleiche Vortrag den schönen und sicherlich nicht bestreitbaren Satz enthielt, alle Erkenntnisse müßten sich eindeutig aus den unmittelbaren Lebens- und Arbeitsbereich anwenden lassen, so müßte sich also die empfohlene Sozialtechnik gerade in diesen unmittelbaren Lebens- und Arbeitsbeziehungen bewähren, und sie würde also alle jene Erfindungen und Vorrichtungen, Methoden und Organisationen umfassen, durch welche das menschliche Miteinander der Ehegatten und Familiengenossen, der Arbeitskollegen und Mit-Hausbewohner erleichtert und zweckmäßiger gestaltet werden könnte. Aber nun sollen also die uns bedrängenden „sozialen” Fragen offenbar Gegenstand einer zweckmäßigen Technik werden. Denn, nicht wahr, die Technik muß doch zweckmäßig sein, und wenn sie sich als unzweckmäßig erweist, so ist sie zweifellos eine schlechte Technik. Immer aber schließt der Begriff der Technik eine bewußte Veranstaltung, ein zweckmäßig gewähltes und angewandtes Mittel, ein Werkzeug, eine Methode, eine Erleichterung und Beschleunigung, wie sie eben das zweckmäßig erdachte Hilfsmittel gewahrt, in sich; sonst wäre es ja vielleicht gar ein einfaches menschliches Verhalten, eine „Handlung”, zu der die Hand (vielleicht in Verbindung mit dem Mund, der etwas zu sagen hat) ausreicht. Zu Fuß gehen ist keine Technik, Autofahren ist Technik; einen Gruß mit der Hand auf eine Karte schreiben, ist eine vortechnische Handlung; telefonisch ein Telegramm aufgeben, ist die technisch höher entwickelte Unternehmung. Also bitte „Sozialtechnik”! Da der gleiche Vortrag den schönen und sicherlich nicht bestreitbaren Satz enthielt, alle Erkenntnisse müßten sich eindeutig aus den unmittelbaren Lebens- und Arbeitsbereich anwenden lassen, so müßte sich also die empfohlene Sozialtechnik gerade in diesen unmittelbaren Lebens- und Arbeitsbeziehungen bewähren, und sie würde also alle jene Erfindungen und Vorrichtungen, Methoden und Organisationen umfassen, durch welche das menschliche Miteinander der Ehegatten und Familiengenossen, der Arbeitskollegen und Mit-Hausbewohner erleichtert und zweckmäßiger gestaltet werden könnte.
 Brauchbare Erfindungen auf diesem „Sektor” werden sicherlich sehr gefragt sein. Vielleicht würde bei anhaltendem Nachdenken jemand auf den Gedanken kommen, daß jede Sozialtechnik, um nicht heißzulaufen und mehr Schaden als Nutzen anzurichten, in ihrem Getriebe das Öl der sehr altmodischen Liebe nötig hat, und ohne diese einfache und einfältige Liebe von Mensch zu Mensch zu den fragwürdigen Ersatzbildungen gehört, die uns, zumeist in fremdsprachlicher Reklamekleidung, empfohlen werden. - Meine Freunde, laßt uns solchen und ähnlichen Worten gegenüber nüchtern, zäh und unerbittlich fragen, was damit in Wahrheit gemeint sein soll, und wie das Ding aussieht, wenn es uns auf der „Ebene” unserer alltäglichen Wirklichkeit begegnet! Brauchbare Erfindungen auf diesem „Sektor” werden sicherlich sehr gefragt sein. Vielleicht würde bei anhaltendem Nachdenken jemand auf den Gedanken kommen, daß jede Sozialtechnik, um nicht heißzulaufen und mehr Schaden als Nutzen anzurichten, in ihrem Getriebe das Öl der sehr altmodischen Liebe nötig hat, und ohne diese einfache und einfältige Liebe von Mensch zu Mensch zu den fragwürdigen Ersatzbildungen gehört, die uns, zumeist in fremdsprachlicher Reklamekleidung, empfohlen werden. - Meine Freunde, laßt uns solchen und ähnlichen Worten gegenüber nüchtern, zäh und unerbittlich fragen, was damit in Wahrheit gemeint sein soll, und wie das Ding aussieht, wenn es uns auf der „Ebene” unserer alltäglichen Wirklichkeit begegnet!
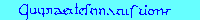
 Die Aufsätze von Reinhold Niebuhr, die „The Lutheran” (Organ der United Lutheran Church in America) veröffentlicht, sind immer lesenswert und lehrreich. In der Nummer 8 vom 21. November v. J. sagt N. (im Anschluß an das Buch von George Kennan über „Amerikanische Diplomatie 1900-1950”), unsere politischen Pläne entsprängen der anmaßenden Meinung, wir könnten die Zukunft in unserem Sinn festlegen. Ein gutes Beispiel dafür sei die „Entmilitarisierung unserer deutschen und japanischen Feinde”, „nur um sie 5 Jahre später zu bitten, unsere militärischen Verbündeten zu werden gegen einen neuen Feind, der unser Bundesgenosse im Kampf gegen jene gewesen war”. „Die Wurzel solcher Schwierigkeiten ist ein ‚Humanismus’, der kein Verständnis für die Grenzen der menschlichen Macht hat; er weiß nichts von der biblischen Wahrheit, daß Sünde Hochmut ist, genauer gesagt: der Hochmut, mit dem sich der Mensch für den Meister seines Schicksals und der Geschichte hält. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, daß das meiste Unheil in der Welt nicht aus bösem Willen kommt, sondern aus einem ‚Idealismus’, der die Grenze zwischen Gott und Mensch verwischt.” Die Aufsätze von Reinhold Niebuhr, die „The Lutheran” (Organ der United Lutheran Church in America) veröffentlicht, sind immer lesenswert und lehrreich. In der Nummer 8 vom 21. November v. J. sagt N. (im Anschluß an das Buch von George Kennan über „Amerikanische Diplomatie 1900-1950”), unsere politischen Pläne entsprängen der anmaßenden Meinung, wir könnten die Zukunft in unserem Sinn festlegen. Ein gutes Beispiel dafür sei die „Entmilitarisierung unserer deutschen und japanischen Feinde”, „nur um sie 5 Jahre später zu bitten, unsere militärischen Verbündeten zu werden gegen einen neuen Feind, der unser Bundesgenosse im Kampf gegen jene gewesen war”. „Die Wurzel solcher Schwierigkeiten ist ein ‚Humanismus’, der kein Verständnis für die Grenzen der menschlichen Macht hat; er weiß nichts von der biblischen Wahrheit, daß Sünde Hochmut ist, genauer gesagt: der Hochmut, mit dem sich der Mensch für den Meister seines Schicksals und der Geschichte hält. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, daß das meiste Unheil in der Welt nicht aus bösem Willen kommt, sondern aus einem ‚Idealismus’, der die Grenze zwischen Gott und Mensch verwischt.”
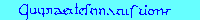
 Meine Klage über das mangelnde Echo auf meinen „Brief” hat mir eine Reihe von Zuschriften verschafft, durch die ich mich nun, sehr viel mehr als bisher, in ein lebhaftes Gespräch mit einer ganzen Anzahl von Lesern versetzt fühle. Ich wäre dankbar, wenn die Leser diese meine Bitte als dauernde Aufforderung verstehen und mich teilnehmen lassen an ihrer Zufriedenheit oder Unzufriedenheit, an ihren Erfahrungen, Fragen und Sorgen. Meine Klage über das mangelnde Echo auf meinen „Brief” hat mir eine Reihe von Zuschriften verschafft, durch die ich mich nun, sehr viel mehr als bisher, in ein lebhaftes Gespräch mit einer ganzen Anzahl von Lesern versetzt fühle. Ich wäre dankbar, wenn die Leser diese meine Bitte als dauernde Aufforderung verstehen und mich teilnehmen lassen an ihrer Zufriedenheit oder Unzufriedenheit, an ihren Erfahrungen, Fragen und Sorgen.
Evangelische Jahresbriefe 1952, S. 103-108
|



