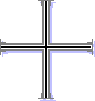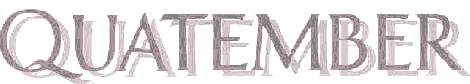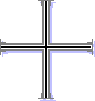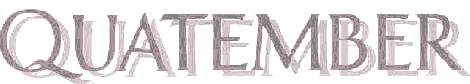Zur Berechtigung, zur Notwendigkeit und zur Aufgabe einer solchen Namenreihe soll hier mit einem Wort von Bischof Martin Haug Stellung genommen werden, das er im Oktober 1945 dem Buch „Schwäbische Glaubenszeugen” mit auf den Weg gab: „Erst in der Anfechtung des Glaubens lernt die Gemeinde mit ganzem Ernst aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der ihr vorangeht auf dem Wunderweg durch Nacht zum Licht, durch Kreuz zur Krone. Zugleich lernt sie dabei auch um sich sehen auf die Wolke von Zeugen, die sie auf ihrem schweren Weg umgibt und ihr Mut machen kann, in ihrem Lauf nicht zu ermatten. Wir brauchen im Dunkel unseres Weges nicht nur die Heimkehr zum Wort, sondern auch die Heimkehr zu den Vätern, die vor uns durchs dunkle Tal in Gottes wunderbarem Licht gewandelt sind und etwas von seinem Glanz auf ihrem Antlitz und in ihrem Leben widerspiegeln.” Im übrigen sei auf die Vorworte von Willi Kramp und Wilhelm Stählin in meinem Buch „Die Wolke der Zeugen” verwiesen. Zur Berechtigung, zur Notwendigkeit und zur Aufgabe einer solchen Namenreihe soll hier mit einem Wort von Bischof Martin Haug Stellung genommen werden, das er im Oktober 1945 dem Buch „Schwäbische Glaubenszeugen” mit auf den Weg gab: „Erst in der Anfechtung des Glaubens lernt die Gemeinde mit ganzem Ernst aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der ihr vorangeht auf dem Wunderweg durch Nacht zum Licht, durch Kreuz zur Krone. Zugleich lernt sie dabei auch um sich sehen auf die Wolke von Zeugen, die sie auf ihrem schweren Weg umgibt und ihr Mut machen kann, in ihrem Lauf nicht zu ermatten. Wir brauchen im Dunkel unseres Weges nicht nur die Heimkehr zum Wort, sondern auch die Heimkehr zu den Vätern, die vor uns durchs dunkle Tal in Gottes wunderbarem Licht gewandelt sind und etwas von seinem Glanz auf ihrem Antlitz und in ihrem Leben widerspiegeln.” Im übrigen sei auf die Vorworte von Willi Kramp und Wilhelm Stählin in meinem Buch „Die Wolke der Zeugen” verwiesen.
 Eine evangelische Namenreihe muß so beschaffen sein, daß alle evangelischen Gliedkirchen in ihr die Wolke von Zeugen zu erkennen vermögen, auf die uns der Hebräerbrief verweist, und zugleich muß sie ein Abbild der ökumenischen Weite der Kirche sein. Weil die Kirche vor der Reformation auch unsere Kirche ist, muß die Namenreihe die Jahrhunderte vor der Reformation, die grundlegend für die Kirche waren, in gleicher Weise berücksichtigen. Die Namenreihe muß aus der Sicht und Erkenntnis unserer Zeit für unsere Zeit erarbeitet werden; kommende Geschlechter werden sie dort korrigieren, wo wir aus zu kurzem Abstand oder aus Befangenheit falsch gesehen haben, und werden sie weiterführen in ihre Stunde. Eine evangelische Namenreihe muß so beschaffen sein, daß alle evangelischen Gliedkirchen in ihr die Wolke von Zeugen zu erkennen vermögen, auf die uns der Hebräerbrief verweist, und zugleich muß sie ein Abbild der ökumenischen Weite der Kirche sein. Weil die Kirche vor der Reformation auch unsere Kirche ist, muß die Namenreihe die Jahrhunderte vor der Reformation, die grundlegend für die Kirche waren, in gleicher Weise berücksichtigen. Die Namenreihe muß aus der Sicht und Erkenntnis unserer Zeit für unsere Zeit erarbeitet werden; kommende Geschlechter werden sie dort korrigieren, wo wir aus zu kurzem Abstand oder aus Befangenheit falsch gesehen haben, und werden sie weiterführen in ihre Stunde.
 Die Bemühungen um eine solche Namenreihe begannen vor bald dreißig Jahren und müssen jetzt zu einem vorläufigen Abschluß gebracht werden. Mit der Herausgabe des „ Gottesjahres” zu Beginn der zwanziger Jahre hat Wilhelm Stählin auch eine Namenreihe übernommen, die Engel und Dämonen, Heilige und Ketzer, Kirchenväter und Irrgeister umfaßte, und das wurde zunächst damit verteidigt: es hätte jeder sein Fündlein beitragen müssen nach Gottes Willen. -Diese Einstellung entsprach der Haltung der Jugendbewegung, die bereit war; vieles gelten zu lassen und von allem etwas zu lernen. Aber die dunkle Seite wurde immer mehr zurückgedrängt, und es blieben die Menschen, auf die Jesus Christus die Hand gelegt hat, Menschen seiner Nachfolge. Die Bemühungen um eine solche Namenreihe begannen vor bald dreißig Jahren und müssen jetzt zu einem vorläufigen Abschluß gebracht werden. Mit der Herausgabe des „ Gottesjahres” zu Beginn der zwanziger Jahre hat Wilhelm Stählin auch eine Namenreihe übernommen, die Engel und Dämonen, Heilige und Ketzer, Kirchenväter und Irrgeister umfaßte, und das wurde zunächst damit verteidigt: es hätte jeder sein Fündlein beitragen müssen nach Gottes Willen. -Diese Einstellung entsprach der Haltung der Jugendbewegung, die bereit war; vieles gelten zu lassen und von allem etwas zu lernen. Aber die dunkle Seite wurde immer mehr zurückgedrängt, und es blieben die Menschen, auf die Jesus Christus die Hand gelegt hat, Menschen seiner Nachfolge.
 Fünfzehn Jahre lang hat Wilhelm Stählin, unterstützt von Brüdern, an der Aufstellung dieser Namenreihe gearbeitet und hat seine Leser oft über diese Bemühungen unterrichtet. Wiederholt hat er auch auf ein Lesebuch hingewiesen, in dem diese Gestalten umrissen seien, und hat dieses Buch angekündigt. Wer das weiß, wird begreifen, mit welcher Anteilnahme er meine Arbeit an der „Wolke der Zeugen” verfolgt und wie froh er -und nicht nur er -war, daß ein langgegebenes Wort endlich wenigstens zu einem Teil eingelöst werden konnte. Im Jahr 1937 schrieb Wilhelm Stählin, die Namenreihe gewinne jetzt die Gestalt eines kirchlichen Namenkalenders, wie man ihn unserer Kirche wünschen müsse. Im Jahre darauf gab aber das „Gottesjahr” notgedrungen das Kalendarium auf, um der hemmenden Zensur zu entgehen, welcher die Kalender und Jahrbücher unterworfen waren. Im gleichen Jahr übernahm ich die Namenreihe in den Neuwerkkalender, um sie zu erhalten; die Weiterarbeit aber geriet ins Stocken. Eine politische Namenreihe wurde aufgenötigt und mußte an erster Stelle gebracht werden, Namen, die in der politischen Reihe standen, durften nicht im kirchlichen Kalender stehen, und Namen, die mißfielen, wurden von der Zensur einfach gestrichen. Fünfzehn Jahre lang hat Wilhelm Stählin, unterstützt von Brüdern, an der Aufstellung dieser Namenreihe gearbeitet und hat seine Leser oft über diese Bemühungen unterrichtet. Wiederholt hat er auch auf ein Lesebuch hingewiesen, in dem diese Gestalten umrissen seien, und hat dieses Buch angekündigt. Wer das weiß, wird begreifen, mit welcher Anteilnahme er meine Arbeit an der „Wolke der Zeugen” verfolgt und wie froh er -und nicht nur er -war, daß ein langgegebenes Wort endlich wenigstens zu einem Teil eingelöst werden konnte. Im Jahr 1937 schrieb Wilhelm Stählin, die Namenreihe gewinne jetzt die Gestalt eines kirchlichen Namenkalenders, wie man ihn unserer Kirche wünschen müsse. Im Jahre darauf gab aber das „Gottesjahr” notgedrungen das Kalendarium auf, um der hemmenden Zensur zu entgehen, welcher die Kalender und Jahrbücher unterworfen waren. Im gleichen Jahr übernahm ich die Namenreihe in den Neuwerkkalender, um sie zu erhalten; die Weiterarbeit aber geriet ins Stocken. Eine politische Namenreihe wurde aufgenötigt und mußte an erster Stelle gebracht werden, Namen, die in der politischen Reihe standen, durften nicht im kirchlichen Kalender stehen, und Namen, die mißfielen, wurden von der Zensur einfach gestrichen.
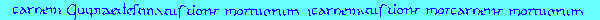
 Als ich mich im Jahre 1942 auf Wilhelm Stählins Aufforderung an die Arbeit machte, das Lesebuch zum Kalendarium zu erarbeiten, wagte ich es nur im Hinblick darauf, daß das Kalendarium erarbeitet und, wie mir schien, vollendet war; denn zur Erarbeitung einer solchen Namenreihe hätte mir der kirchengeschichtliche Überblick gefehlt. Im Zuge der Arbeit aber stellte es sich heraus, daß die Arbeit am Kalendarium noch einmal einsetzen muß. Die Namenreihe war im Jahre 1938 noch nicht völlig ausgereift, und seither haben sich die Erkenntnisse und Einblicke vertieft, neue Namen sind wichtig geworden, und alte Namen haben neuen Glanz gewonnen. Darum möchte ich alle Leser, die Einsicht und Kenntnis haben, um Mitarbeit bitten, damit die Namenreihe zu einer gültigen Gestalt ausreife. Ich frage: Als ich mich im Jahre 1942 auf Wilhelm Stählins Aufforderung an die Arbeit machte, das Lesebuch zum Kalendarium zu erarbeiten, wagte ich es nur im Hinblick darauf, daß das Kalendarium erarbeitet und, wie mir schien, vollendet war; denn zur Erarbeitung einer solchen Namenreihe hätte mir der kirchengeschichtliche Überblick gefehlt. Im Zuge der Arbeit aber stellte es sich heraus, daß die Arbeit am Kalendarium noch einmal einsetzen muß. Die Namenreihe war im Jahre 1938 noch nicht völlig ausgereift, und seither haben sich die Erkenntnisse und Einblicke vertieft, neue Namen sind wichtig geworden, und alte Namen haben neuen Glanz gewonnen. Darum möchte ich alle Leser, die Einsicht und Kenntnis haben, um Mitarbeit bitten, damit die Namenreihe zu einer gültigen Gestalt ausreife. Ich frage:
- Welche Gestalten sind fehl am Platz und sind durch andere zu ersetzen?
- Auf welche Gestalten kann notfalls verzichtet werden?
- Welche Gestalten fehlen und sollten unbedingt aufgenommen werden?
- Welche Gestalten möchte man außerdem im Kalendarium sehen, unter Umständen in einer zweiten Namenreihe?
 Die Gestalten sollten mit dem Sterbedatum genannt werden; zweckmäßig wäre auch die Angabe eines biographischen Werkes, in dem man einen Lebensabriß der Gestalt findet. Die Gestalten sollten mit dem Sterbedatum genannt werden; zweckmäßig wäre auch die Angabe eines biographischen Werkes, in dem man einen Lebensabriß der Gestalt findet.
 Bei der Aufstellung einer Namenreihe handelt es sich nicht darum, die 365 wichtigsten kirchlichen Namen ausfindig zu machen und auf die Tage des Jahres zu verteilen; das wäre keine leichte, aber eine vielleicht lösbare Aufgabe. Die Zeugen sollen mit ihrem Todestag im Kalendarium erscheinen, und es bleibt also immer nur die Auswahl zwischen den Gestalten, die unter dem gleichen Datum gestorben sind. Dadurch wird die Auswahl sehr erschwert, und manche bedeutsame Gestalt kann nicht untergebracht werden. Wenn man dabei die Anliegen bedenkt, die außerdem zu berücksichtigen sind, so wird klar, daß es zwar leicht ist, eine Namenreihe zu kritisieren, daß es aber andererseits eine saure Arbeit ist, eine Namenreihe aufzustellen und ihr eine gültige Gestalt zu verleihen. Bei der Aufstellung einer Namenreihe handelt es sich nicht darum, die 365 wichtigsten kirchlichen Namen ausfindig zu machen und auf die Tage des Jahres zu verteilen; das wäre keine leichte, aber eine vielleicht lösbare Aufgabe. Die Zeugen sollen mit ihrem Todestag im Kalendarium erscheinen, und es bleibt also immer nur die Auswahl zwischen den Gestalten, die unter dem gleichen Datum gestorben sind. Dadurch wird die Auswahl sehr erschwert, und manche bedeutsame Gestalt kann nicht untergebracht werden. Wenn man dabei die Anliegen bedenkt, die außerdem zu berücksichtigen sind, so wird klar, daß es zwar leicht ist, eine Namenreihe zu kritisieren, daß es aber andererseits eine saure Arbeit ist, eine Namenreihe aufzustellen und ihr eine gültige Gestalt zu verleihen.
 Was entscheidet für die Aufnahme? In erster Linie nicht die kirchgeschichtliche Bedeutung, sondern das geheiligte Leben, nicht die Lehre, sondern die Heiligung, nicht das Werk, sondern der Mensch. Vielleicht wird unter diesem Gesichtspunkt mancher „Schulmeister” und „Streittheologe” des Reformationsjahrhunderts fraglich. Was entscheidet für die Aufnahme? In erster Linie nicht die kirchgeschichtliche Bedeutung, sondern das geheiligte Leben, nicht die Lehre, sondern die Heiligung, nicht das Werk, sondern der Mensch. Vielleicht wird unter diesem Gesichtspunkt mancher „Schulmeister” und „Streittheologe” des Reformationsjahrhunderts fraglich.
 Die legendären Gestalten? Wie die Bücher der heiligen Schrift ein verschiedenes Verhältnis zur Historie haben, und so wenig die Genesis in ihrem Wahrheitsgehalt dadurch angezweifelt wird, daß Karl Barth sie streckenweise als „Sage” bezeichnet, so müssen wir es uns gefallen lassen, daß auch die Kirchengeschichte in Tiefen reicht, wo die Maßstäbe der Historie versagen, und dürfen doch das ruhige Gewissen haben, daß nicht nur das Historische wahr ist, sondern auch die Legende Wahrheit aussagen kann. Christophorus, Sebastian, Barbara, Katharina und andere kann man nicht übergehen, als wären sie nicht vorhanden. Die legendären Gestalten? Wie die Bücher der heiligen Schrift ein verschiedenes Verhältnis zur Historie haben, und so wenig die Genesis in ihrem Wahrheitsgehalt dadurch angezweifelt wird, daß Karl Barth sie streckenweise als „Sage” bezeichnet, so müssen wir es uns gefallen lassen, daß auch die Kirchengeschichte in Tiefen reicht, wo die Maßstäbe der Historie versagen, und dürfen doch das ruhige Gewissen haben, daß nicht nur das Historische wahr ist, sondern auch die Legende Wahrheit aussagen kann. Christophorus, Sebastian, Barbara, Katharina und andere kann man nicht übergehen, als wären sie nicht vorhanden.
 Sollen nach der Reformation auch noch Katholiken aufgenommen werden? Die aufzunehmenden Namen müssen gültige Namen sein auch für die katholische Kirche. Nie dürfen Gestalten unter dem Gesichtspunkt aufgenommen werden, daß man damit die andere Kirche kritisieren könne, wie man andererseits wesentliche Dinge nicht verschweigen darf, wenn sie auch bittere Wahrheiten bedeuten. Es wird ersichtlich, daß hinter der Namenreihe eine bestimmte Schau der Kirche steht, daß die Namenreihe ein Bekenntnis darstellt. Sollen nach der Reformation auch noch Katholiken aufgenommen werden? Die aufzunehmenden Namen müssen gültige Namen sein auch für die katholische Kirche. Nie dürfen Gestalten unter dem Gesichtspunkt aufgenommen werden, daß man damit die andere Kirche kritisieren könne, wie man andererseits wesentliche Dinge nicht verschweigen darf, wenn sie auch bittere Wahrheiten bedeuten. Es wird ersichtlich, daß hinter der Namenreihe eine bestimmte Schau der Kirche steht, daß die Namenreihe ein Bekenntnis darstellt.
 Die Namenreihe beginnt sich durchzusetzen, sie erscheint nicht nur im „Neuwerkboten” und einigen anderen Buchkalendern, sondern z. B. auch im „Pfarramtskalender”. Um so wichtiger ist es - auch im Hinblick auf die fortschreitende Arbeit an der „Wolke der Zeugen” -, daß das Kalendarium seine endgültige Gestalt gewinne. Die Namenreihe beginnt sich durchzusetzen, sie erscheint nicht nur im „Neuwerkboten” und einigen anderen Buchkalendern, sondern z. B. auch im „Pfarramtskalender”. Um so wichtiger ist es - auch im Hinblick auf die fortschreitende Arbeit an der „Wolke der Zeugen” -, daß das Kalendarium seine endgültige Gestalt gewinne.
Quatember 1953, S. 32-33
|