 Jeder, der Bischof Dibelius als den Vorsitzenden des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland verehrt und liebt, kann es nur schmerzlich bedauern, daß sein Name nun in eine innerevangelische Polemik hineingezogen ist. Daß er von außen her, aus dem politischen Raum angegriffen wird, gehört sozusagen zu den notwendigen Begleiterscheinungen seines bischöflichen Amtes, und es wäre unheimlich, wenn es nicht geschähe; aber daß ihm aus den Reihen derer, die sich gern uneingeschränkt hinter ihn stellen möchten, widersprochen werden muß, kann niemand erfreuen. Im Zusammenhang mit den Verhandlungen über die neue Agende der „Evangelischen Kirche der altpreußischen Union” (neuerdings „Evangelische Kirche der Union” genannt) hat D. Dibelius im Berliner Sonntagsblatt „Die Kirche” temperamentvoll vor den beabsichtigten Änderungen gewarnt und diesem Widerstand die Parole gegeben: „Wir wollen bei Bortniansky bleiben.” (Bortniansky war jener Hofmusiker russischer Abstammung, der für die Unionsagende Friedrich Wilhelms III, 1822 den größten Teil der musikalischen Formen geschaffen hat, die sich heute noch innerhalb der ehemals preußischen Provinzen einer großen Beliebtheit erfreuen.) Darauf haben an gleicher Stelle D. Söhngen und neuerdings Otto Brodde in der Zeitschrift „Der Kirchenchor” (XIV, 2; Beilage zu „Musik und Kirche”, 24, 2, März/April 1954) geantwortet und alles gesagt, was vom Standort des Kirchenmusikers und Liturgikers gegen Dibelius gesagt werden kann und wohl auch gesagt werden muß. Ich habe nicht das Bedürfnis, hier zu wiederholen, was dort mit großer Sachkenntnis ausgeführt worden ist; vielleicht wird sich auch nur ein kleiner Teil unserer Leser für jene liturgiewissenschaftlichen Einzelheiten interessieren. Doch scheint mir in dieser Meinungsverschiedenheit über liturgische Stilfragen ein tieferer Dissensus zum Ausdruck zu kommen, um des willen allein diese Polemik uns so tief, und ich wiederhole das Wort: so schmerzlich bewegt. Dibelius hatte gegen die alten liturgischen Singweisen, die zum Teil aus der Reformationszeit, zum Teil aus der vorreformatorischen Kirche stammen, nicht nur dieses eingewandt, daß sie dem heutigen musikalischen Empfinden fremd seien, sondern daß sie einen „gedämpften Klang” haben, mehr dem Moll als dem Dur zugehören, daß sie besser in das Halbdunkel mittelalterlicher Dome als in die evangelische Kirche und zu dem hellen Licht des Evangeliums passen. In der evangelischen Kirche solle „Luthers frohe seligmachende Botschaft” „mit lauter hellen Vokalen” erklingen, und über jedem Chorraum und jeder Kanzel stehe „Siehe, ich verkündige euch große Freude”, und eben diesem Grundton des Evangeliums entspreche die Musik von Bortniansky mit seinen hellen, klaren, freudigen Melodien besser als jene aus der Vergangenheit heute wieder hervorgeholten Weisen. Jeder, der Bischof Dibelius als den Vorsitzenden des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland verehrt und liebt, kann es nur schmerzlich bedauern, daß sein Name nun in eine innerevangelische Polemik hineingezogen ist. Daß er von außen her, aus dem politischen Raum angegriffen wird, gehört sozusagen zu den notwendigen Begleiterscheinungen seines bischöflichen Amtes, und es wäre unheimlich, wenn es nicht geschähe; aber daß ihm aus den Reihen derer, die sich gern uneingeschränkt hinter ihn stellen möchten, widersprochen werden muß, kann niemand erfreuen. Im Zusammenhang mit den Verhandlungen über die neue Agende der „Evangelischen Kirche der altpreußischen Union” (neuerdings „Evangelische Kirche der Union” genannt) hat D. Dibelius im Berliner Sonntagsblatt „Die Kirche” temperamentvoll vor den beabsichtigten Änderungen gewarnt und diesem Widerstand die Parole gegeben: „Wir wollen bei Bortniansky bleiben.” (Bortniansky war jener Hofmusiker russischer Abstammung, der für die Unionsagende Friedrich Wilhelms III, 1822 den größten Teil der musikalischen Formen geschaffen hat, die sich heute noch innerhalb der ehemals preußischen Provinzen einer großen Beliebtheit erfreuen.) Darauf haben an gleicher Stelle D. Söhngen und neuerdings Otto Brodde in der Zeitschrift „Der Kirchenchor” (XIV, 2; Beilage zu „Musik und Kirche”, 24, 2, März/April 1954) geantwortet und alles gesagt, was vom Standort des Kirchenmusikers und Liturgikers gegen Dibelius gesagt werden kann und wohl auch gesagt werden muß. Ich habe nicht das Bedürfnis, hier zu wiederholen, was dort mit großer Sachkenntnis ausgeführt worden ist; vielleicht wird sich auch nur ein kleiner Teil unserer Leser für jene liturgiewissenschaftlichen Einzelheiten interessieren. Doch scheint mir in dieser Meinungsverschiedenheit über liturgische Stilfragen ein tieferer Dissensus zum Ausdruck zu kommen, um des willen allein diese Polemik uns so tief, und ich wiederhole das Wort: so schmerzlich bewegt. Dibelius hatte gegen die alten liturgischen Singweisen, die zum Teil aus der Reformationszeit, zum Teil aus der vorreformatorischen Kirche stammen, nicht nur dieses eingewandt, daß sie dem heutigen musikalischen Empfinden fremd seien, sondern daß sie einen „gedämpften Klang” haben, mehr dem Moll als dem Dur zugehören, daß sie besser in das Halbdunkel mittelalterlicher Dome als in die evangelische Kirche und zu dem hellen Licht des Evangeliums passen. In der evangelischen Kirche solle „Luthers frohe seligmachende Botschaft” „mit lauter hellen Vokalen” erklingen, und über jedem Chorraum und jeder Kanzel stehe „Siehe, ich verkündige euch große Freude”, und eben diesem Grundton des Evangeliums entspreche die Musik von Bortniansky mit seinen hellen, klaren, freudigen Melodien besser als jene aus der Vergangenheit heute wieder hervorgeholten Weisen.

 Hier aber wird offenbar, daß es sich eben doch nicht um eine bloße Frage des musikalischen Stils handelt, bei der Pastor und Organist bereit sein müssen (wie Dibelius verlangt), „ihr musikalisches Ideal zu verleugnen”. Niemand wird uns im Verdacht haben, daß wir den Freudencharakter des christlichen Gottesdienstes, den hohen Ton der „Eucharistie”, zu Gunsten einer weinerlichen Weltschmerzlichkeit und eines verkrampften Sündengefühls beeinträchtigen lassen wollten. Aber es ist eine eigentümliche Sache mit diesem Freudenklang. In der Ostergeschichte heißt es (Matth. 28, 8), daß die Frauen das leere Grab verlassen haben „mit Furcht und großer Freude”, und in dem Psalm (2, 11), der der nächtlichen Feier des Weihnachtsfestes zugeordnet ist, heißt es „freuet euch mit Zittern”. Man sollte nicht behaupten, daß Luther offenbar nicht mehr genau gewußt oder jedenfalls nicht bedacht habe, was Kyrieleis bedeutete, wenn er jede Strophe seines jubelnden Weihnachtsliedes eben nicht mit Halleluja, sondern mit Kyrieleis abschloß; und gerade die größten und freudenvollsten Lieder Luthers selbst und seiner Zeitgenossen lassen in allem jubelnden Lobpreis der erlösten Kinder Gottes jenen abgründigen Ernst der Angst und Verzweiflung ahnen, den die ungebrochene Festmusik Bortnianskys so empfindlich vermissen läßt, und ohne den doch die „seligmachende Botschaft” so leicht zu einer allgemeinen Beruhigung und Selbstbestätigung des natürlichen Menschen verfälscht wird. „Hoch und hell”, „Luthers helle Vokale”: Ist damit die Art der durch das Evangelium erweckten Freude richtig beschrieben? Ist Bortniansky nur deswegen so beliebt, weil er unserem (?) musikalischen Empfinden so nahe steht, weil er nun zugleich ein Stück heimatlicher Gewohnheit ist und dergleichen, oder auch deswegen, weil man ihn so unbekümmert und „ohne Furcht und Zittern” singen kann, weil er nicht mehr in unbequemer Weise daran erinnert, daß die parrhesia (die Freudigkeit) des Christenmenschen getroste Verzweiflung ist? Wir fürchten, daß die Äußerungen unseres verehrten D. Dibelius als eine Apologie dieser ganz innerlichen Fehlentwicklung verstanden und mißbraucht werden könnten; wenn wir aber Bortniansky als den musikalischen Wortführer dieser religiösen Entartung empfinden, und wenn wir die Sorge haben, daß er eben d a r u m so beliebt ist, dürfen wir dann bei Bortniansky bleiben? Hier aber wird offenbar, daß es sich eben doch nicht um eine bloße Frage des musikalischen Stils handelt, bei der Pastor und Organist bereit sein müssen (wie Dibelius verlangt), „ihr musikalisches Ideal zu verleugnen”. Niemand wird uns im Verdacht haben, daß wir den Freudencharakter des christlichen Gottesdienstes, den hohen Ton der „Eucharistie”, zu Gunsten einer weinerlichen Weltschmerzlichkeit und eines verkrampften Sündengefühls beeinträchtigen lassen wollten. Aber es ist eine eigentümliche Sache mit diesem Freudenklang. In der Ostergeschichte heißt es (Matth. 28, 8), daß die Frauen das leere Grab verlassen haben „mit Furcht und großer Freude”, und in dem Psalm (2, 11), der der nächtlichen Feier des Weihnachtsfestes zugeordnet ist, heißt es „freuet euch mit Zittern”. Man sollte nicht behaupten, daß Luther offenbar nicht mehr genau gewußt oder jedenfalls nicht bedacht habe, was Kyrieleis bedeutete, wenn er jede Strophe seines jubelnden Weihnachtsliedes eben nicht mit Halleluja, sondern mit Kyrieleis abschloß; und gerade die größten und freudenvollsten Lieder Luthers selbst und seiner Zeitgenossen lassen in allem jubelnden Lobpreis der erlösten Kinder Gottes jenen abgründigen Ernst der Angst und Verzweiflung ahnen, den die ungebrochene Festmusik Bortnianskys so empfindlich vermissen läßt, und ohne den doch die „seligmachende Botschaft” so leicht zu einer allgemeinen Beruhigung und Selbstbestätigung des natürlichen Menschen verfälscht wird. „Hoch und hell”, „Luthers helle Vokale”: Ist damit die Art der durch das Evangelium erweckten Freude richtig beschrieben? Ist Bortniansky nur deswegen so beliebt, weil er unserem (?) musikalischen Empfinden so nahe steht, weil er nun zugleich ein Stück heimatlicher Gewohnheit ist und dergleichen, oder auch deswegen, weil man ihn so unbekümmert und „ohne Furcht und Zittern” singen kann, weil er nicht mehr in unbequemer Weise daran erinnert, daß die parrhesia (die Freudigkeit) des Christenmenschen getroste Verzweiflung ist? Wir fürchten, daß die Äußerungen unseres verehrten D. Dibelius als eine Apologie dieser ganz innerlichen Fehlentwicklung verstanden und mißbraucht werden könnten; wenn wir aber Bortniansky als den musikalischen Wortführer dieser religiösen Entartung empfinden, und wenn wir die Sorge haben, daß er eben d a r u m so beliebt ist, dürfen wir dann bei Bortniansky bleiben?
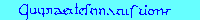
 Selten bin ich von einer mit Vorträgen und Aussprachen reich beladenen Tagung so tief bewegt und reich beschenkt nach Hause gefahren wie von der Tagung, die die Evangelische Akademie für Schleswig-Holstein im März dieses Jahres in der Volkshochschule Rendsburg unter dem Gesamtthema „Verantwortung” veranstaltet hatte: Ärzte, Männer des öffentlichen Versicherungswesens, Richter und Rechtsgelehrte sprachen über die Verantwortung des Kranken für seine Krankheit, des Verbrechers für sein Verbrechen, zugleich über die Verantwortung des Arztes und des Richters für die Kranken und Verbrecher, mit denen er es zu tun hat. Das Erstaunliche dieser Vorträge (das in der Aussprache noch deutlicher zutage trat) war, daß der Arzt, der Leiter eines großen Krankenhauses, ebenso wie der Psychiater mit Nachdruck von der Verantwortung des Kranken für den Verlauf seiner Krankheit redeten, und daß der Theoretiker des Strafrechts mit gleichem Nachdruck den Verbrecher nicht als den entgleisten Sonderfall, sondern als den unverhüllten Menschen, wie er wirklich ist, darstellte. Die Grenzen zwischen der „Freiheit” gegenüber übermächtigen Zwängen und der Verantwortung sind fließend, und weder der Arzt tut dem Kranken, noch der Richter dem Verbrecher einen Dienst, wenn er ihn als das schuldlose Opfer von Zwängen entschuldigt. „Der Bereich der Verantwortung ist größer als der Bereich der Freiheit”, und indem wir den Menschen in seinem Kampf mit krankhaften Tendenzen oder verbrecherischen Neigungen zur Verantwortung rufen, erweitern wir den Bereich seiner Freiheit. - Diese paar Sätze können und wollen nur andeuten, in welcher Richtung in erregender Gemeinsamkeit die Gedanken jener Tage sich bewegten, und warum diese Tage als ein Symptom einer tiefgreifenden, heilsamen und zukunftsträchtigen Wandlung empfunden wurden. Ich nehme an und hoffe, daß die Vorträge und ein Bericht über die ganze Tagung veröffentlicht werden. Selten bin ich von einer mit Vorträgen und Aussprachen reich beladenen Tagung so tief bewegt und reich beschenkt nach Hause gefahren wie von der Tagung, die die Evangelische Akademie für Schleswig-Holstein im März dieses Jahres in der Volkshochschule Rendsburg unter dem Gesamtthema „Verantwortung” veranstaltet hatte: Ärzte, Männer des öffentlichen Versicherungswesens, Richter und Rechtsgelehrte sprachen über die Verantwortung des Kranken für seine Krankheit, des Verbrechers für sein Verbrechen, zugleich über die Verantwortung des Arztes und des Richters für die Kranken und Verbrecher, mit denen er es zu tun hat. Das Erstaunliche dieser Vorträge (das in der Aussprache noch deutlicher zutage trat) war, daß der Arzt, der Leiter eines großen Krankenhauses, ebenso wie der Psychiater mit Nachdruck von der Verantwortung des Kranken für den Verlauf seiner Krankheit redeten, und daß der Theoretiker des Strafrechts mit gleichem Nachdruck den Verbrecher nicht als den entgleisten Sonderfall, sondern als den unverhüllten Menschen, wie er wirklich ist, darstellte. Die Grenzen zwischen der „Freiheit” gegenüber übermächtigen Zwängen und der Verantwortung sind fließend, und weder der Arzt tut dem Kranken, noch der Richter dem Verbrecher einen Dienst, wenn er ihn als das schuldlose Opfer von Zwängen entschuldigt. „Der Bereich der Verantwortung ist größer als der Bereich der Freiheit”, und indem wir den Menschen in seinem Kampf mit krankhaften Tendenzen oder verbrecherischen Neigungen zur Verantwortung rufen, erweitern wir den Bereich seiner Freiheit. - Diese paar Sätze können und wollen nur andeuten, in welcher Richtung in erregender Gemeinsamkeit die Gedanken jener Tage sich bewegten, und warum diese Tage als ein Symptom einer tiefgreifenden, heilsamen und zukunftsträchtigen Wandlung empfunden wurden. Ich nehme an und hoffe, daß die Vorträge und ein Bericht über die ganze Tagung veröffentlicht werden.
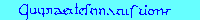
 Daß katholische Bücher, zumal wenn sie in einem ausgesprochen katholischen Verlag erscheinen, eines ausdrücklichen Imprimatur, das heißt einer Druckerlaubnis seitens der dafür zuständigen bischöflichen Zensurstelle bedürfen, ist bekannt. Weniger bekannt sind die rechtlichen Voraussetzungen dieser Einrichtung und die Bedingungen, unter denen dieses Imprimatur gewährt (oder versagt) wird. Es handelt sich hier um eine für den ganzen Bereich der römisch-katholischen Kirche geltende Bestimmung des corpus juris canonici, welches bestimmt, daß bei jedem bischöflichen Ordinariat (und ebenso bei der Leitung der großen Orden) eine Zensurstelle eingerichtet wird, welche alle Schriften, die innerhalb dieses Bereichs gedruckt werden sollen, daraufhin prüft, ob sie mit der Glaubens- und Sittenlehre der römisch-katholischen Kirche übereinstimmen; nur Abweichungen von der offiziellen Glaubens- und Sittenlehre können die Ablehnung des Imprimatur rechtfertigen. Das bedeutet auf der einen Seite, daß diese bischöfliche Aufsicht den Druck solcher Bücher verhindern kann, in denen häretische theologische Gedanken oder von der Norm abweichende ethische Anschauungen vertreten werden; auf der anderen Seite bleibt diese Zensur notwendigerweise an sehr formale Maßstäbe gebunden. Wir wundern uns bisweilen darüber, was für fragwürdige Druckerzeugnisse das bischöfliche Imprimatur bekommen haben; katholische Theologen, mit denen ich darüber gesprochen habe, machen mich nachdrücklich darauf aufmerksam, daß die Zensur zum Beispiel keine Möglichkeit habe, schlimme Geschmacklosigkeiten, offenbaren Kitsch volkstümlicher Schriftchen, Bildchen usw. zu verhindern, weil sie nicht „der katholischen Glaubens- und Sittenlehre” widersprechen; auch Schriften, die im Dienst der konfessionellen Polemik die „Unterscheidungslehren” darstellen, können und dürfen nur darauf geprüft werden, ob darin die katholische Lehre, nicht aber darauf, ob auch die evangelische Lehre richtig dargestellt ist. Auch wäre es unrecht, die Bischöfe persönlich dafür verantwortlich zu machen, was von den betreffenden Amtsstellen ihrer Ordinariate gebilligt oder verworfen wird. (Wie weit bei den Orden dieses Imprimatur anders, das heißt etwa weniger nach rechtlichen als nach wahrhaft geistlichen und seelsorgerlichen Gesichtspunkten gehandhabt wird, entzieht sich meiner Kenntnis.) Wir halten es im allgemeinen für einen Vorzug unserer evangelischen Kirche, daß in ihr die Freiheit der Äußerung nicht durch eine kirchliche Zensur eingeengt und also weder Autoren noch Leser innerhalb bestimmter fester Schranken gehalten werden. Doch könnten wir uns sehr wohl eine Ordnung denken, an die sich kirchliche Autoren gerade um ihrer kirchlichen Verantwortung willen freiwillig und gern binden, bei der sie brüderlichen Rat suchen und bei der sie weniger gesetzliche Verbote als brüderliche Hilfe finden bei ihrem eigenen Bemühen, die Wahrheit zu erkennen, die erkannte Wahrheit sachgemäß zu sagen und mit dem gedruckten ebenso wie mit dem gesprochenen Wort nicht bloß „ihre Meinung zu sagen”, sondern einen Dienst an den Seelen zu ihrem Heil zu tun. Daß katholische Bücher, zumal wenn sie in einem ausgesprochen katholischen Verlag erscheinen, eines ausdrücklichen Imprimatur, das heißt einer Druckerlaubnis seitens der dafür zuständigen bischöflichen Zensurstelle bedürfen, ist bekannt. Weniger bekannt sind die rechtlichen Voraussetzungen dieser Einrichtung und die Bedingungen, unter denen dieses Imprimatur gewährt (oder versagt) wird. Es handelt sich hier um eine für den ganzen Bereich der römisch-katholischen Kirche geltende Bestimmung des corpus juris canonici, welches bestimmt, daß bei jedem bischöflichen Ordinariat (und ebenso bei der Leitung der großen Orden) eine Zensurstelle eingerichtet wird, welche alle Schriften, die innerhalb dieses Bereichs gedruckt werden sollen, daraufhin prüft, ob sie mit der Glaubens- und Sittenlehre der römisch-katholischen Kirche übereinstimmen; nur Abweichungen von der offiziellen Glaubens- und Sittenlehre können die Ablehnung des Imprimatur rechtfertigen. Das bedeutet auf der einen Seite, daß diese bischöfliche Aufsicht den Druck solcher Bücher verhindern kann, in denen häretische theologische Gedanken oder von der Norm abweichende ethische Anschauungen vertreten werden; auf der anderen Seite bleibt diese Zensur notwendigerweise an sehr formale Maßstäbe gebunden. Wir wundern uns bisweilen darüber, was für fragwürdige Druckerzeugnisse das bischöfliche Imprimatur bekommen haben; katholische Theologen, mit denen ich darüber gesprochen habe, machen mich nachdrücklich darauf aufmerksam, daß die Zensur zum Beispiel keine Möglichkeit habe, schlimme Geschmacklosigkeiten, offenbaren Kitsch volkstümlicher Schriftchen, Bildchen usw. zu verhindern, weil sie nicht „der katholischen Glaubens- und Sittenlehre” widersprechen; auch Schriften, die im Dienst der konfessionellen Polemik die „Unterscheidungslehren” darstellen, können und dürfen nur darauf geprüft werden, ob darin die katholische Lehre, nicht aber darauf, ob auch die evangelische Lehre richtig dargestellt ist. Auch wäre es unrecht, die Bischöfe persönlich dafür verantwortlich zu machen, was von den betreffenden Amtsstellen ihrer Ordinariate gebilligt oder verworfen wird. (Wie weit bei den Orden dieses Imprimatur anders, das heißt etwa weniger nach rechtlichen als nach wahrhaft geistlichen und seelsorgerlichen Gesichtspunkten gehandhabt wird, entzieht sich meiner Kenntnis.) Wir halten es im allgemeinen für einen Vorzug unserer evangelischen Kirche, daß in ihr die Freiheit der Äußerung nicht durch eine kirchliche Zensur eingeengt und also weder Autoren noch Leser innerhalb bestimmter fester Schranken gehalten werden. Doch könnten wir uns sehr wohl eine Ordnung denken, an die sich kirchliche Autoren gerade um ihrer kirchlichen Verantwortung willen freiwillig und gern binden, bei der sie brüderlichen Rat suchen und bei der sie weniger gesetzliche Verbote als brüderliche Hilfe finden bei ihrem eigenen Bemühen, die Wahrheit zu erkennen, die erkannte Wahrheit sachgemäß zu sagen und mit dem gedruckten ebenso wie mit dem gesprochenen Wort nicht bloß „ihre Meinung zu sagen”, sondern einen Dienst an den Seelen zu ihrem Heil zu tun.
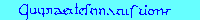
 Seit wir im Jahre 1926 das „Berneuchener Buch” hatten ausgehen lassen und an seinem Mißerfolg begriffen hatten, wie geringe Wirkungsmöglichkeiten das geschriebene und gedruckte Wort hat, bedrückt mich immer mehr eine bestimmte Beobachtung. Da können in Büchern, Aufsätzen oder Vorträgen die aufregendsten Dinge gesagt werden: Die Leser oder Hörer nehmen sie mit ostentativem Beifall oder ein bißchen lächelnd zur Kenntnis; niemand macht ernsthaft den Versuch zu zeigen, daß das falsch sei, was da gesagt worden ist; vielmehr besteht eine allgemeine Übereinstimmung darüber, daß der Mann „eigentlich” recht hat - aber niemals wird eine Folgerung daraus gezogen. Man sieht ein, daß das falsch ist, wie man geredet und gehandelt hat-, aber man denkt gar nicht daran, es zu ändern. Ein lieber Amtsbruder sagte mir einmal: „Ich weiß, daß ich auf einem toten Gleis fahre, aber ich kann die Weichen nicht mehr umstellen.” Ich führe keine Beispiele an, damit niemand meint, ich nehme Dinge, die ich gelegentlich gesagt habe, zu wichtig. Aber man möchte manchmal schreien: Liebe Leute, wenn ich etwas falsches gesagt habe, so zeigt mir doch, daß ich Unrecht habe; zieht mich zur Rechenschaft, wenn ich verkehrte Dinge geredet oder geschrieben habe; verbietet mir den Mund, wenn ich Irrtümer verbreite. Aber legt um Gottes willen nicht richtige Erkenntnisse, die euch aufgegangen sind, in die Schublade! Was wird aus uns, wenn wir uns daran gewöhnen, Fehler einzusehen, aber nicht zu bessern, Einsichten auf Lager zu haben, aber keine Konsequenzen daraus zu ziehen! Die Fähigkeit und Übung, das Wahre zu erkennen und dann nicht zu vollziehen, ist eine schauderhafte und seelengefährliche Fähigkeit! Seit wir im Jahre 1926 das „Berneuchener Buch” hatten ausgehen lassen und an seinem Mißerfolg begriffen hatten, wie geringe Wirkungsmöglichkeiten das geschriebene und gedruckte Wort hat, bedrückt mich immer mehr eine bestimmte Beobachtung. Da können in Büchern, Aufsätzen oder Vorträgen die aufregendsten Dinge gesagt werden: Die Leser oder Hörer nehmen sie mit ostentativem Beifall oder ein bißchen lächelnd zur Kenntnis; niemand macht ernsthaft den Versuch zu zeigen, daß das falsch sei, was da gesagt worden ist; vielmehr besteht eine allgemeine Übereinstimmung darüber, daß der Mann „eigentlich” recht hat - aber niemals wird eine Folgerung daraus gezogen. Man sieht ein, daß das falsch ist, wie man geredet und gehandelt hat-, aber man denkt gar nicht daran, es zu ändern. Ein lieber Amtsbruder sagte mir einmal: „Ich weiß, daß ich auf einem toten Gleis fahre, aber ich kann die Weichen nicht mehr umstellen.” Ich führe keine Beispiele an, damit niemand meint, ich nehme Dinge, die ich gelegentlich gesagt habe, zu wichtig. Aber man möchte manchmal schreien: Liebe Leute, wenn ich etwas falsches gesagt habe, so zeigt mir doch, daß ich Unrecht habe; zieht mich zur Rechenschaft, wenn ich verkehrte Dinge geredet oder geschrieben habe; verbietet mir den Mund, wenn ich Irrtümer verbreite. Aber legt um Gottes willen nicht richtige Erkenntnisse, die euch aufgegangen sind, in die Schublade! Was wird aus uns, wenn wir uns daran gewöhnen, Fehler einzusehen, aber nicht zu bessern, Einsichten auf Lager zu haben, aber keine Konsequenzen daraus zu ziehen! Die Fähigkeit und Übung, das Wahre zu erkennen und dann nicht zu vollziehen, ist eine schauderhafte und seelengefährliche Fähigkeit!
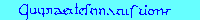
 Etwa gleichzeitig mit diesem Heft erscheint meine kleine Schrift „Die ausgesonderten Tage” (Johannes Stauda-Verlag; 88 S. Preis DM 3.80). Die Schrift ist herausgewachsen aus einer Arbeitsgemeinschaft, in der wir vor mehreren Jahren unsere Erfahrungen bei Freizeiten, Geistlichen Wochen und ähnlichen Veranstaltungen ausgetauscht und versucht haben, Richtlinien für die rechte Gestaltung solcher Wochen zu gewinnen. Sie faßt den Ertrag einer mehr als 20-jährigen Arbeit zusammen, gibt Rechenschaft über die Richtung, in der wir dabei weitergeführt worden sind und in der wir weitergehen müssen. Ich glaube, daß das Bild solcher „ausgesonderten Tage”, das hier gezeichnet wird, nicht nur für unseren eigenen Kreis verpflichtend ist, sondern daß es gültig ist für alle solche Veranstaltungen, die durch „repräsentative Aussonderung” der Weckung und Pflege geistlichen Lebens dienen wollen. Daß an vielen Punkten die Grundsätze und Erfahrungen der retreat-Bewegung innerhalb der anglikanischen Kirche eingearbeitet sind, wird dieser Aufgabe in besonderem Maß förderlich sein. Weil alle solchen Wochen nicht nur eine „Veranstaltung für...” sind, sondern auf einen gemeinsamen Vollzug und die tätige Mitarbeit aller Teilnehmer angewiesen sind, so ist die Schrift nicht nur für „Freizeitleiter” bestimmt, sondern ebenso auch für alle Teilnehmer, damit durch klare Erkenntnis dessen, was hier eigentlich gemeint ist, ihre Mitarbeit umso aktiver und fruchtbarer werden kann. Etwa gleichzeitig mit diesem Heft erscheint meine kleine Schrift „Die ausgesonderten Tage” (Johannes Stauda-Verlag; 88 S. Preis DM 3.80). Die Schrift ist herausgewachsen aus einer Arbeitsgemeinschaft, in der wir vor mehreren Jahren unsere Erfahrungen bei Freizeiten, Geistlichen Wochen und ähnlichen Veranstaltungen ausgetauscht und versucht haben, Richtlinien für die rechte Gestaltung solcher Wochen zu gewinnen. Sie faßt den Ertrag einer mehr als 20-jährigen Arbeit zusammen, gibt Rechenschaft über die Richtung, in der wir dabei weitergeführt worden sind und in der wir weitergehen müssen. Ich glaube, daß das Bild solcher „ausgesonderten Tage”, das hier gezeichnet wird, nicht nur für unseren eigenen Kreis verpflichtend ist, sondern daß es gültig ist für alle solche Veranstaltungen, die durch „repräsentative Aussonderung” der Weckung und Pflege geistlichen Lebens dienen wollen. Daß an vielen Punkten die Grundsätze und Erfahrungen der retreat-Bewegung innerhalb der anglikanischen Kirche eingearbeitet sind, wird dieser Aufgabe in besonderem Maß förderlich sein. Weil alle solchen Wochen nicht nur eine „Veranstaltung für...” sind, sondern auf einen gemeinsamen Vollzug und die tätige Mitarbeit aller Teilnehmer angewiesen sind, so ist die Schrift nicht nur für „Freizeitleiter” bestimmt, sondern ebenso auch für alle Teilnehmer, damit durch klare Erkenntnis dessen, was hier eigentlich gemeint ist, ihre Mitarbeit umso aktiver und fruchtbarer werden kann.
Quatember 1954, S. 186-189
|



